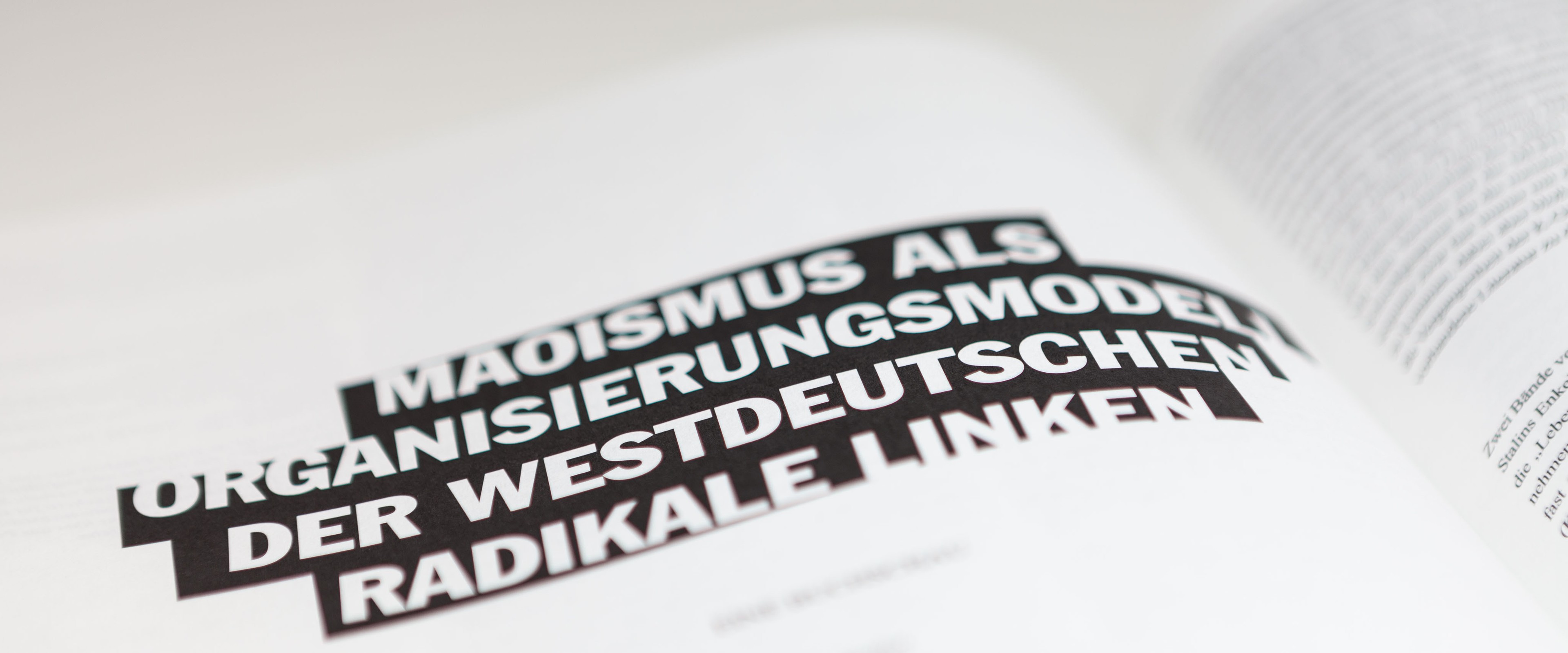Für die K-Gruppen galt, die Milieubegrenzung der studentischen Bewegung aufzuheben und die revolutionäre Begeisterung ihrer Aktivist*innen in die Arbeiter*innenklasse zu tragen – als deren einzig echte Vertretung sich die diversen K-Gruppen in der Regel selbst wahrnahmen, inklusive allem damit verbundenen Sektierertum und Konkurrenzkampf. Und vor allem: meist grandioser Erfolgslosigkeit. Ihre geschichte endet – mit Ausnahmen – bereits wieder Anfang der 1980er Jahre. Größtenteils gingen ihre Mitglieder in die zu diesem Zeitpunkt entstehende Partei der grünen oder in immer neue zerstrittene und isolierte Kleinstzirkel über. Die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) stellt heute die einzige verbliebene K-Gruppe dar, der noch eine relevanz innerhalb der Linken zugesprochen werden kann.
Mit dem Verweis auf die MLPD wird allerdings auch klar, dass die K-gruppen heute vor allem ein Schreckgespenst für die meisten Linken darstellen. Neuere organisierungsdebatten werden in der Konsequenz zwar fast immer mit dem Ziel geführt, dem Kommunismus endlich wieder einen Schritt näher zu kommen, dabei aber bloß keine neue „K-Gruppe“ zu werden. Und gerade deshalb lohnt ein Blick in die Vergangenheit der K-Gruppen: um an emanzipatorischeren Organisierungsmodellen zu arbeiten. Die vorhandene Literatur zu den K-Gruppen fällt dabei aber höchst unterschiedlich in der Bewertung aus.
Überblickswerke: Phänomenal Geschmacksneutral?
Zwei bände versprechen, zunächst einen Überblick über die K-Gruppen in den 1970er Jahren zu geben: Stalins Enkel, Maos Söhne, die umgearbeitete Dissertation von Andreas Kühn, verspricht im Untertitel die „Lebenswelt der K-Gruppen“ darzustellen. Es ist die bislang (mehr oder weniger) einzige ernst zu nehmende wissenschaftliche Untersuchung über den Gesamtkomplex der K-Gruppen, wobei sich Kühn fast ausschließlich auf die KPD / ML, die Kommunistische Partei Deutschlands /Aufbauorganisation (KPD/AO) und den Kommunistischen Bund Westdeutschland (KBW) konzentriert. Er schildert unter anderem die Organisation und Struktur der einzelnen Gruppen, den Habitus der Partei und ihrer Kader, deren Alltag und Ideologie sowie die Agitationsversuche, das Geschichtsbild und die öffentlichen Aktivitäten der genannten gruppen. Als grundlage dafür dienen ihm primär Zeitungen der jeweiligen Organisierungen. Das liest sich recht kurzweilig – abgesehen von mehreren unnötigen Wiederholungen, was wahrscheinlich der streng abgetrennten Kapiteleinteilung geschuldet ist. Das Problem ist hier eher die Art, in der Kühn sein material einordnet: Stichwortgeber für die Beurteilung sind nervig oft die beiden Extremismustheoretiker und Linkenhasser Uwe Backes und Eckhard Jesse sowie Gerd Koenen, der als ehemaliger KBWler nur noch Spott und Zynismus übrig hat, wenn es um die (Post-)68er-Linke geht. Kühns starke politische Distanz zu seinem Gegenstand führt dazu, dass man nach der Lektüre zwar die vielen schlimmen inhaltlichen und organisatorischen Ausfälle der K-Gruppen zu kennen glaubt, die Frage, wie linke Politik und Organisation diese Erfahrung (gerade auch als Negativmoment) verarbeiten könnte, aber ungeklärt bleibt. Kühn interessieren die K-Gruppen schließlich auch bloß als Faszinosum. So scheut er auch nicht, sie sogar mit faschistischen Organisationen gleichzusetzen. Warum also nicht unwesentliche viele Linke freiwillig nach den teilweise äußerst repressiv strukturierten K-Gruppen strebten und dabei oftmals auch noch so bescheuerte Positionen vertraten, erklärt Kühn so banal wie unbefriedigend mit simpler Generationspsychologie.
Zudem führt die fast alleinige Fokussierung auf die Parteiblätter dazu, dass sich dann doch weniger zu „Lebenswelt“ und Alltagskultur der K-Gruppen in dem Text findet, als der Titel verspricht. Echte „Interna“ aus den Gruppen fehlen in der Regel, denn meist sind diese ja auch nicht aus den Veröffentlichungen demokratisch-zentralistischer Organisationen zu erfahren. Was allerdings deutlich wird, ist, wie stark sich der Bewertungsrahmen von der antiautoritären Bewegung hin zu den K-Gruppen verschoben hat. Zuvor als konservativ und „spießig“ abgetane Charakterzüge galten nun als „proletarisch“ und damit revolutionär. Gerade Pünktlichkeit und Disziplin waren, dem „Ernst der lage“ angemessen, wieder gefragt. Insbesondere in Sexualitäts-, Kultur- oder Wohnfragen hatten sich die Parteikader grundsätzlich so zu verhalten, wie man es auch von der ihnen doch recht unbekannten Arbeiter*innenklasse annahm – mit maximalem Konformismus.
Der zweite Versuch einer Gesamtdarstellung der K-gruppen, Anton Stengls Zur Geschichte der K-Gruppen, ist allerdings noch viel schlimmer geraten – wenn auch aus teilweise gegenteiligen Gründen. So merkt man bei Stengl permanent, dass ihm der Ansatz der K-gruppen, eine neue „anti-revisionistische“ wie revolutionäre KP als Avantgarde der werktätigen deutschen Bevölkerung aufzubauen, eigentlich recht klug erschien – und immer noch erscheint. „Gegen die Unwissenschaftlichkeit in Bezug auf die neuste Zeitgeschichte“ will Stengl anschreiben und so „die Ursachen für die Fehler in ihrer Politik [der K-Gruppen] und für ihr letztendliches Scheitern“ erkunden. Diese hochtrabende Ankündigung wird aber leider keineswegs umgesetzt. Weder hat man im Nachgang der Lektüre das Gefühl, eine „wissenschaftliche“ Auseinandersetzung erlebt zu haben, noch will Stengls Fehleranalyse überzeugen. Denn diese reduziert sich eigentlich bloß auf die These, die K-Gruppen seien einfach nicht in der Lage gewesen, die an sich richtige politische Linie des Marxismus-Leninismus „lebendig“, „mitreißend“ und „kreativ“ genug zu denken. Über die frage der Organisierung selbst wird nicht nachgedacht. Faktisch hat, nach Stengl, also bloß die Führung versagt. Zur „Wissenschaftlichkeit“ ist zudem anzumerken, dass aufgrund der häufigen Wiederholungen und dem Fehlen von Nachweisen der Eindruck entsteht, der Text habe nie ein Lektorat gesehen. Dazu kommen ständige Beurteilungen ohne nachvollziehbare Argumente, dafür aber immer mit Ausrufezeichen (!). Ist die unvermittelte Neigung zur Herausgabe von Parolen in Stengls Text vielleicht noch ein Nachwirken seiner laut Autoreninfo eigenen Zeit in den K-Gruppen?
Der KB im Fokus
Dagegen ist Michael Steffens Geschichten vom Trüffelschwein – ebenfalls eine überarbeitete Dissertation – eine gelungene wie umfassende Einzeldarstellung des Kommunistischen Bundes (KB). Schwerpunkt ist auch hier die Hochzeit der marxistisch-lenistischen (ML-) Bewegung in den Jahren von 1971 bis zur ersten KB-Spaltung 1979. Steffens arbeitet aber auch die weitere Entwicklung des KB heraus, der im Gegensatz zu dem Großteil seiner Konkurrenz bis 1991 als „Kleingruppe“ von wenigen hundert Mitgliedern noch mehr oder weniger handlungsfähig weiterexistierte.
Steffens arbeit zeichnet sich im Gegensatz zu Kühn durch einen emphatischen Bezug auf ihren Gegenstand aus, ohne aber wie Stengl ins Apologetische zu verfallen. Aus heutiger Sicht ist der KB dort spannend, wo er sich wohltuend von den anderen K-Gruppen unterscheidet: Steffen attestiert dem KB einen, trotz aller ML-Dogmatik vorhandenen politischen „Pragmatismus“ und eine Offenheit in der Themenwahl. Damit verbunden soll sich der KB als durchaus bündnisfähig erwiesen haben. Auch ersparte er sich aufgrund der eingestandenen gesamtgesellschaftlichen Marginalität mit maximal 2500 Mitgliedern die Beteiligung an Parlamentswahlen. Ferner war der KB in der lage, zumindest zeitweise eine relevante rolle in der entstehenden Anti-AKW-bewegung zu spielen – alle anderen K-Gruppen scheiterten daran mehr oder weniger. Und schließlich war der KB, laut Steffens, in der Lage, sich phasenweise tatsächlich in Hamburger Großbetrieben zu verankern.
Dazu kommt, dass der KB die außenpolitischen Kurswechsel der VR China weniger ernst als andere K-Gruppen nahm: der angeblich „sozialimperialistische Charakter“ der UdSSR, der diese als noch gefährlichere Supermacht als die USA definierte, spielte laut Steffen im KB keine rolle. Indem sich der KB vergleichsweise früh von China als „sozialistischem Vaterland“ lossagte, konnte er sich einige politische Irrgänge ersparen (wie beispielsweise, die von der KPD/AO übernommene patriotische Position der deutschen „Vaterlandsverteidigung“ gegenüber der UdSSR). Mit der Annahme einer zunehmenden Faschisierung von Staat und Gesellschaft in der Bundesrepublik übernahm er zudem eine ambivalente und weniger optimistische Einschätzung für seine „revolutionäre“ politik. Trotzdem war der KB dem Selbstverständnis nach eine weitere streng disziplinierte, zentralistische und damit eben leninistische Kaderpartei, um die hier nicht der Mythos der einzig „guten“ K-Gruppe entstehen sollte. Auch der KB hat seine Mitglieder in zeitlicher und finanzieller Hinsicht stark eingespannt und dirigiert. Besonders skurril erscheint in diesem Zusammenhang, dass die mitglieder des „leitenden Gremium[s]“ (dem Quasi-Zentralkomitee des KB) der Basis bis 1980 unbekannt blieben, da sie schlicht zu keiner einzigen Wahl antreten mussten. Steffens schildert auch eine fragwürdige Bündnispolitik des KB, der sich mitunter durch mehrere „Briefkasteninitativen“ Legitimation im Kontext der grün-alternativen Wahlbewegung zu verschaffen suchte. Das auch vom KB reproduzierte zwanghafte Abgrenzungsbedürfnis der K-Gruppen untereinander dokumentiert zudem ein Anhang mit den „besten KBW-Schmähwitzen“ seitens des Hamburger Bundes. Zu bemängeln ist, dass es keine zusammenfassende Abgrenzung zwischen dem KB und den anderen K-Gruppen oder auch der sonstigen Hamburger Linken gibt. Zudem liegt Steffens Fokus sehr stark auf der Politik des KB, sodass nur wenig aus seinem innerorganisatorischem Alltag beziehungsweise dem seiner Kader zu erfahren ist.
Erfahrungen mit der K-Gruppe
Einen noch einmal ganz anderen – radikal subjektiven – Blickwinkel auf das Feld der K-Gruppen bietet der bereits 1977 erstmals erschiene Sammelband Wir warn die stärkste der Partein der aus den Erfahrungsberichten ehemaliger (anonymer) Aktivist*innen besteht (in der regel aus KPD/AO beziehungsweise KBW). Ihr Ziel war es, die eigenen Erfahrungen zu einem „Bestandteil des politischen Lernprozesses innerhalb der Linken“ zu machen. Für sie bleibt die „Überwindung von Sektierertum [...] in einer gesellschaftlich noch immer relativ isolierten Linken eine permanente Aufgabe“. Die Beitragenden berichten gemeinsam davon, dass sie erst aus der Distanz zu ihren alten Organisierungen bemerkten, wie sehr sich „ihre“ K-Gruppen eine imaginäre Realität ausmalten – und auch sie selbst sich eine künstliche Identität zulegten.
Ein Beitrag beschreibt die Belastung, die es bedeutete, permanent alle Leute danach zu bewerten, ob sie eventuelle „Arbeiterverräter“ seien. Beklagt werden zudem ein permanenter Rechtfertigungszwang sowie die Kontrolle des Privatlebens. Auch dass in der nach außen dargestellten Aufopferung der Einzelnen für die Partei dann doch immer viel Simulation lag, wird in mehreren Beiträgen deutlich. Das Schönreden von erfolglosen Aktivitäten, zum Beispiel beim Verkauf von Zeitungen, wird ebenfalls mehrmals angeführt. In einem Beitrag wird betont, dass der eigene Aktivismus als überhaupt nicht selbstbestimmt, sondern rein verplant wahrgenommen wurde. Ein weiterer Aktivist thematisiert die Entfremdung zwischen der politischen Arbeit und den eigenen Bedürfnissen in „seiner“ Gruppe. Was also lässt sich für neue linksradikale Organisierungsversuche aus der gescheiterten Geschichte der K-Gruppen mitunter lernen?
Auf dem Teppich bleiben: Einsichten linksradikaler Praxis
Der Avantgardismus der K-Gruppen verleitete vor allem dazu, sich aneinander abzuarbeiten und sich permanent selbst darin bestätigen zu müssen, die richtige Linie zu vertreten, während alle anderen nur falsch liegen konnten. Ein derart unsolidarisches Konkurrenzverhalten gilt es innerhalb einer ohnehin marginalisierten radikalen Linken zu vermeiden. Zwar ist die Gefahr dafür geringer geworden, da ein derart explizites Avantgardemodell heute von (fast) niemandem mehr vertreten wird. Trotzdem sollten sich auch heutige linksradikale Organisierungen nicht dazu hinreißen zu lassen, nach „außen“ wie „innen“ hin mehr Stärke und Geschlossenheit vorzutäuschen, als real vorhanden ist oder ihre Möglichkeiten und ihren Einfluss selbst so maßlos überschätzen, wie dies einige K-Gruppen taten. Denn die Gefahr der Selbstüberschätzung kehrt vielleicht mit den kleinen Erfolgen zurück, die darin liegen, erneut bundesweit handlungsfähige linksradikale Strukturen aufzubauen.
Wegen der Überbeanspruchung ihrer Mitglieder, gleichermaßen durch Avantgardismus und strikte Hierarchien begünstigt, kehrten viele den Parteien frühzeitig den Rücken zu. Ihr Aktivismus laugte sie früher oder später aus, zumal ein Großteil der Aktivitäten nur der Selbstdarstellung der Parteien diente. Ehemalige Studierende, die ihr Studium beendet hatten, um im auftrag der Parteien in die Fabrik zu gehen und so näher am Proletariat zu sein, konnten wieder an die Unis zurück. Wer diese Option nicht hatte, stand vor einem Problem. Faktisch hatten sich die K-Gruppen allerdings oMnehin nie in dem maße „proletariarisiert“, wie sie es gern gehabt hätten. In jedem Fall kann festgehalten werden, dass eine politische Organisierung nicht überlebensfähig ist, wenn sie die konkreten Bedürfnisse ihrer Mitglieder immer dann als „kleinbürgerlich“ abwertet, sobald sie im Konflikt zu den Erwartungen der Partei stehen.
Eine solche Haltung hat fatale Auswirkungen auf eine radikale Linke, besonders dann, wenn diese davor zurückweicht, sich nach realen gesellschaftlichen interessen – oder auch nur denen ihrer Mitglieder – zu organisieren. Statt die eigene Politik aus den Verhältnissen vor Ort zu bestimmen, wurde sich im K-Gruppen-Kontext an den zweifelhaften politischen Linien aus Peking oder Tirana orientiert. Was die K-Gruppen vielfach praktizierten, war eine Form „imaginärer“ Stellvertreterpolitik, eine Politik von oben herab. Sie gaben den „Proleten“ deren „wirkliche“ Interessen immer wieder vor. Eine Überprüfung, inwieweit diese bei den Arbeiter*innen tatsächlich vorhanden waren, musste gar nicht erst vorgenommen werden – die historische Tendenz würde es irgendwann schon richten. Selbstverständlich ist umgekehrt auch nicht alles, was von „unten“ kommt, automatisch emanzipatorisch. aber es gilt für die radikale linke weiterhin, einen Weg jenseits des simplen Dualismus von „Stellvertretung“ oder einer „Politik der ersten Person“ zu finden. In dieser Hinsicht kann man es sogar durchaus positiv finden, dass sich die K-Gruppen von der Randgruppentheorie der Studierendenbewegung abgrenzten und mit ihrer Politik in die Fabriken zurückkehrten – was allerdings auch die von ihnen so geschmähten Spontis taten.