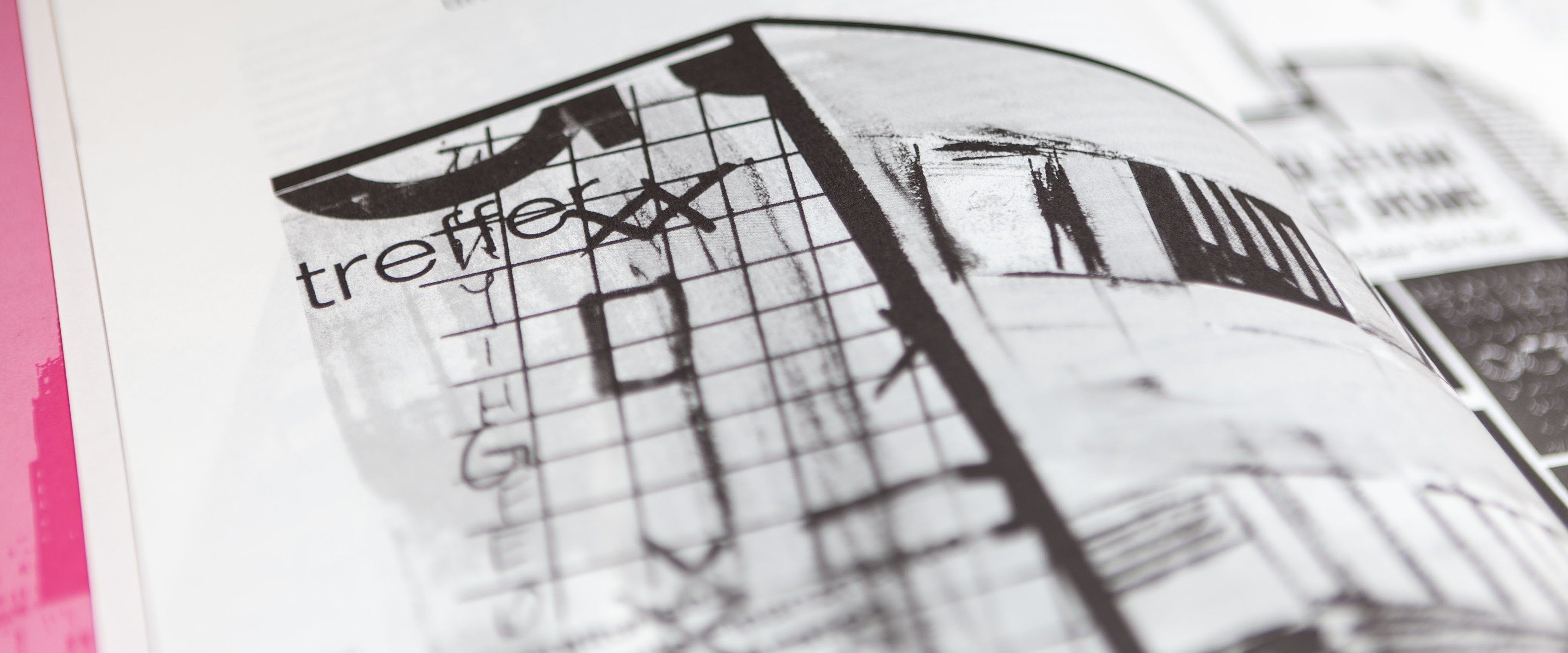Die Geschichte des Internationalismus hatte einen fulminanten Anfang. Marx und Engels forderten 1848 am Ende des Kommunistischen Manifests, dass sich die »Proletarier aller Länder« vereinigen sollen. Seit dieser Zeit hat die Politik des Internationalismus mehrere Wandlungen erlebt. Auch wir – die AG »Internationale Solidarität« (InterSol) der Gruppe FelS (Für eine linke Strömung) – haben in den 14 Jahren seit Bestehen unsere Herangehensweise an das Thema Internationalismus mehrmals geändert und unsere Schwerpunkte verschoben. Hier wollen wir unter anderem diesen Weg nachzeichnen und somit für andere Gruppen und Interessierte transparent machen. Gern würden wir diesen Text als Beitrag zu Debatten darüber verstanden wissen, was einen zeitgemäßen Internationalismus heute ausmacht, wobei wir uns bewusst sind, in unserer politischen Praxis auch nur einen kleinen Teilbereich dessen abzudecken.
Es erscheint uns logisch, dass es nur in internationalistischer Perspek- tive gelingen kann, in vielerlei Hinsicht grenzüberschreitende Herrschaftsstrukturen zu überwinden. Dazu zählt die Solidarität mit emanzipatorischen Bewegungen in anderen Ländern genauso wie der Kampf gegen Rassismus und die Regulierung und Kontrolle von Migration in Deutschland. Nach unserem Verständnis geht es nicht um Solidarität zwischen oder mit bestimmten Nationen; es geht um Solidarität zwischen Menschen, die in unterschiedlichen Staaten leben (müssen). Menschen, die – wenn auch in durchaus unterschiedlicher Weise – mit den gleichen, miteinander verwobenen strukturellen Gewaltverhältnissen zu kämpfen haben: Der Kampf gegen rassistische und sexistische Klassenverhältnisse, gegen Homo- und Transphobie und all ihre Verflech- tungen ist transnational. Er muss es sein, will er nicht in die nationalistische Falle treten.
Die Internationalismus-Bewegung in der BRD – insofern man von einer solchen sprechen kann – war stets sehr heterogen. Betrachtet man den Zeitraum der letzten 50 Jahre, trifft man auf so unterschiedliche und sich doch überlappende Strömungen wie K-Gruppen und sonstige Traditionskommunist_innen, Antiimperialist_innen, die Kirchen und karitative NGOs, das BUKO-Spektrum und autonome bzw. sozialrevolutionäre Strömungen.
Im Laufe dieses Zeitraums fanden auch mehrere Paradigmenwechsel statt, denen sich die wenigsten Beteiligten entziehen konnten. Nachdem in den sechziger und siebziger Jahren, vor allem bestimmt durch den Vietnam-Krieg, ein Internationalismus entstand, der ganz im Sinne des »Kalten Krieges« von einem starken Freund-Feind-Denken bestimmt war und sich auf die recht unkritische Unterstützung nationaler Befreiungsbewegungen stützte, entwickelte sich in den achtziger Jahren eine neue Auffassung von Internationalismus. Diese äußerte sich in neuen Konzepten und Strategien als Reaktion auf die Irrungen und Wirrungen, die teilweise aus dem vorherigen Verständnis von internationalistischer Solidarität und insbesondere aus der recht unkritischen Suche nach Bündnispartner_innen entstanden waren. Beispiele dafür sind etwa die Nicaragua-Solidarität, Kampagnen gegen das Apartheid- Regime in Südafrika oder thematische Projekte wie die von der BUKO 1985 lancierte Stoppt Futtermittelimporte-Kampagne. Bereits bei dieser letztgenannten wurde der Zusammenhang zwischen Hungererzeugung im Süden und Produktion von nicht für den menschlichen Verzehr gedachten Nahrungsmitteln in Ländern des Globalen Südens thematisiert. Als der »Kalte Krieg« und der autoritäre, bürokratische Staatssozialismus am Ende waren, wandelte sich auch die internationalistische Bewegung. Immer häufiger wählte sie nicht den Weg des Kampfes oder der direkten Solidarität mit den militanten Bewegungen, sondern den der Repräsentanz und Aushandlung. Professionalisierung und NGOisierung breiteten sich auf dem Terrain aus, das zuvor von radikalherrschaftskritischen Positionen dominiert wurde. Erst wieder durch den Aufstand der Zapatistischen Befreiungsarmee (EZLN) in Chiapas, Mexiko erlebten diese 1994 einen Neuanfang und vollzogen dabei eine weitere Wandlung. Neben einem undogmatischen Politikkonzept, beispielhaft verbildlicht in der Losung »caminamos preguntando « (»fragend schreiten wir voran«), das die Erringung staatlicher Macht nicht als Ziel der Politik definierte, und dem basisdemokratischen Charakter ihrer lokalen Organisierung, war es vor allem ihre ausdrückliche Solidarisierung und Vernetzung mit vielfältigen sozialen Bewegungen weltweit, die eine weitreichende Faszination der internationalistischen Bewegung in der BRD und vielen anderen Ländern für die zapatistische Bewegung mit sich brachte. »Gegen die Internationale des Schreckens, die der Neoliberalismus darstellt, müssen wir die Internationale der Hoffnung aufstellen«, schrieb die EZLN in ihrer Ersten Erklärung von La Realidad 1996 und lud ein zu mehreren »Interkontinentalen Treffen für die Menschheit und gegen den Neoliberalismus«. Der zapatistische Aufstand war ein wichtiger Referenzpunkt für globalisierungskritische Bewegungen, und in den Anfangsjahren der InterSol auch für diese.
Antirassismus als antikoloniale Praxis: »Wir sind hier, weil ihr unsere Länder zerstört«
Wir hatten den Eindruck, dass Migrant_innen oder von Rassismus negativ betroffene Menschen in den 1960er- und 1970erJahren viel stärker in gemeinsame emanzipatorische Kämpfe in Westdeutschland eingebunden waren, als dies in letzter Zeit der Fall war, auch wenn das gesamtgesellschaftliche Klima vor 40 Jahren bestimmt nicht weniger rassistisch war. Damals gingen die Initialzündungen für wichtige Kämpfe häufig von migrantischen Communities als treibender Kraft aus, wie beispielsweise bei den Protesten gegen den rassistischen Film Africa Addio (August 1965), gegen den Schah-Besuch (1967), beim Streik in den Kölner Ford-Werken (1973) oder beim Häuserkampf in Frankfurt am Main (Anfang der 1970erJahre). Danach kam es unseres Erachtens mehr und mehr zu einer Distanz zwischen von Rassismus negativ betroffenen Menschen und »Bio-Deutschen«1 in geführten Kämpfen. Hier wurden im Zusammenhang mit den Kämpfen im Süden, insbesondere in Nicaragua und El Salvador, im Laufe der 1980er paternalistische Züge deutlich. Es gab demnach zwar in der Bundesrepublik keine revolutionäre Perspektive bzw. Praxis mehr, aber es sollten doch die Länder des Südens die »wahre« Revolution machen und dabei bloß nicht vom Pfad der revolutionären Tugend abweichen. Taten sie dies trotzdem, wand mensch sich sehr schnell von diesen Bewegungen ab. So entzogen Genoss_innen etwa den nicaraguanischen Sandinistas öffentlichkeitswirksam ihre Solidarität, weil sich jene in ihre Augen zu sehr mit der herrschenden Ordnung arrangiert hatten. Hinzu kam, dass seit jener Zeit eine Abkehr vom klassischen, antiimperialistisch orientierten Internationalismus beobachtbar wurde. Antinationale Positionen wurden lauter, die den Bezugspunkt der Kämpfe im Globalen Süden – nationale Befreiung als antikoloniale und antikapitalistische Praxis – kritisierten oder rundheraus ablehnten. Teile der deutschen Linken folgten und wandten sich von Organisationen wie etwa der PKK ab. Die Debatte hinterließ tiefe Gräben in der radikalen Linken.
Ausgangspunkt unserer Überlegungen, erneut über Internationalismus nachzudenken, waren auch die Erfahrungen aus der globalisierungskritischen Bewegung. Nachdem wir erfolgreich zu den G8- Gipfeln in Genua (2001) und Evian (2003) mobilisiert hatten, stellten wir fest, dass unsere politische Arbeit darauf beschränkt blieb, sich im Vorfeld der jeweiligen Ereignisse in Form von inhaltlicher Auseinandersetzung, und Vernetzung zu beteiligen und an Protesten teilzunehmen. Nach dem Event endete die Beschäftigung damit. Diese Art Politik wurde wegen fehlender Kontinuität als nicht ausreichend erachtet. Es gab innerhalb der Gruppe das starke Bedürfnis, sich grundsätzlich mit der Frage des Internationalismus zu beschäftigen. Beginnend mit Frantz Fanons Buch Die Verdammten dieser Erde, das oft auch als »Kommunistisches Manifest der antikolonialen Revolution« bezeichnet wurde, über die Solidaritätsbewegungen der 1970er- und 1980er Jahre bis hin zur globalisierungskritischen Bewegung, setzten wir uns mit der Theorie und Praxis internationaler Solidarität auseinander. Wir kamen zu dem Schluss, dass das Konzept der nationalen Befreiungsbewegungen als systemüberwindendes Projekt gescheitert war, sich aber aus der konkreten Praxis und den gemachten Fehlern Schlüsse für die praktische Arbeit heute gewinnen lassen. In vielen Ländern waren mit der zeitlichen Distanz deutlich die verheerenden Auswirkungen der Machtausübung von ehemals durch linke Internationalist_innen unterstützte, spätere Machthaber zu sehen, beispielsweise im Iran oder in Kambodscha. Gleichzeitig nahmen wir die Befreiungsbewegungen als historische Versuche wahr, sich gegen Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnisse zu wehren.
Bewegung in die erstarrte innerlinke Auseinandersetzung zwischen Antiimperialist_innen und Antinationalen hatte das Auftreten von Flüchtlings-Selbstorganisationen wie The Voice oder der Karawane gebracht. Diese bildeten sich als Reaktion auf die rassistischen Gesetze des so genannten Asylkompromisses von 1993 und verbanden ihren exilpolitischen, antikolonialen Kampf mit dem Widerstand gegen den institutionellen Rassismus in Deutschland. Sie bündelten diese neue Perspektive in dem Slogan »Wir sind hier, weil ihr unsere Länder zerstört «. Damit brachten sie den Zusammenhang zwischen weltweiter kapitalistischer Ausbeutung und Fluchtursachen auf den Punkt. Diese Zuspitzung macht deutlich, dass Migration auch eine Antwort auf die globalen Herrschaftsverhältnisse ist; der Kampf gegen Abschiebung wird aus dieser Perspektive zum Kampf gegen neokoloniale Verhältnisse. Denn auch wenn Migration per se nicht als kollektive politische Praxis verstanden werden kann, wird sie in ihrer faktischen Nichtregulierbarkeit durch den Globalen Norden zu einer widerständigen Praxis, auf die eine internationalistische Linke Bezug zu nehmen hat. Dies war Grundlage unserer Vorbereitung der Demonstration in Berlin gegen Kolonialismus und postkoloniale Kontinuitäten anlässlich des G8-Gipfels in Gleneagles 2005.
Von der Autonomie der Migration zum Recht auf Rechte
Im Laufe der darauf folgenden Praxis zum Bereich Antirassismus mit dem Fokus Flucht und Migration waren wir immer wieder mit Widersprüchen konfrontiert, mit denen es sich auseinanderzusetzen galt. Einige Debatten, die für die AG-Politik bedeutsam waren und sind, wollen wir herausgreifen: Mitte der 2000er Jahre kam in antirassistischen Diskursen die Debatte um die Autonomie der Migration auf. Antirassist_innen, etwa aus dem Umfeld der Gruppe Kanak Attak, stellten dabei den Subjektstatus der Migrierenden heraus und betonten, dass staatliche Politik Migration nicht wirksam steuern und begrenzen könne, weil diese sich solchen Kontrollversuchen immer wieder entziehe und neue »Schlupflöcher« schaffe. Daraus leiteten die Vertreter_innen des Konzeptes Forderungen nach einem »Recht auf Rechte« ab, wie etwa die Gesellschaft für Legalisierung, die sich auf Grundlage der Enttabuisierung und Betonung der Faktizität von irregulärer Migration mit Forderungen nach Legalisierung und kollektiven Rechten in die gesellschaftlichen Diskurse um Migration einbrachte. Die Perspektive von Autonomie der Migration blieb nicht unumstritten. Aktivist_innen der Karawane etwa kritisierten die Vertreter_innen des Ansatzes, sie würden Migration romantisieren und Fluchtgründe politisch ignorieren. Aus feministischer Perspektive wurde angemerkt, dass die exklusiven, hierarchischen Machtstrukturen und Abhängigkeitsverhältnisse innerhalb der Migrationsnetzwerke zu wenig Berücksichtigung fänden.
Die Debatte um die Autonomie der Migration ist mittlerweile abgeflaut, jedoch berührt sie noch immer wesentliche strategische Fragen antirassistischer Politik. In den letzten Jahren gab es vermehrt Versuche unter dem Motto »Recht zu gehen, Recht zu bleiben« Forderungen nach globaler Bewegungsfreiheit mit denen nach »gerechter Entwicklung « und damit nach der Schaffung guter Lebensbedingungen in den Herkunftsregionen vieler Migrant_innen, zu verbinden (so im Falle von Afrique-Europe-Interact). Flüchtlingsorganisationen wie The Voice mobilisierten mit Slogans wie »Gemeinsam gegen koloniales Unrecht« gegen die deutsch-europäische Abschottungspolitik und die Entrechtung von Flüchtlingen in Deutschland. Sie stellen sie in den Kontext der Kolonialgeschichte und deren Kontinuität in Form von fortbestehenden politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Privilegien der Gesellschaften des Globalen Nordens und neokolonialer Ausbeutungsverhältnisse auf dem kapitalistischen Weltmarkt.
In der Folge verstärkten wir unser Engagement gegen die Auswüchse des institutionellen Rassismus gegenüber Flüchtlingen auf lokaler Ebene. Im Rahmen dessen vernetzten wir uns und organisierten gemeinsam mit Bündnispartner_innen Aktionen und Proteste gegen das System der Lagerunterbringung, der Residenzpflicht und der Gutscheinvergabe für Asylbewerber_innen und Menschen mit Duldungsstatus, gegen die Dublin-II-Verordnung (nach der Deutschland Flüchtlinge ohne Prüfung von Asylanträgen in das jeweilige »EU-Eintrittsland« abschieben kann) sowie jüngst gegen den Bau des Asylknasts und die Aufnahme des Flughafenasylverfahrens am neuen Großflughafen Berlin-Schönefeld. FelS war auch beim Grenzcamp auf der griechischen Insel Lesbos 2009 dabei, das seinen Beitrag zur Schließung des berüchtigten Flüchtlingslagers Paganí geleistet haben dürfte. Aktuell beteiligten sich Aktivist_innen neben der kontinuierlichen Arbeit an der Initiative Boats4people, in der vor allem die oft tödlich endende »Flüchtlingsabwehr « durch Frontex im Mittelmeer thematisiert wird sowie am diesjährigen NoBorder-Camp in Köln/Bonn. Der Kampf gegen staatlichen Rassismus und Migrationskontrolle wurde von uns bislang noch zu selten im direkten Zusammenhang mit dem historischen Kontext des Kolonialismus und seiner post- und neokolonialen Kontinuitäten thematisiert. Es fällt auf, dass viele deutsch und weiß2 geprägte Antira- Gruppen die Kolonialgeschichte in ihrer politischen Argumentation oftmals vernachlässigen, während sie in Gruppen der Selbstorganisation, vor allem afrikanischer Flüchtlinge, eine wichtige Rolle spielen.
Die AG Internationale Solidarität war in ihren Anfängen keine Gruppe weißer deutscher Aktivist_innen, vielmehr hatten ihre Mitglieder eigene negative Rassismuserfahrungen, sie bekam aber im Laufe der Zeit die Tendenz, eine weiße Gruppe zu werden. Besonders in den letzten Jahren jedoch arbeiten in der AG Menschen mit unterschiedlich privilegiertem und diskriminiertem Status entlang der Herrschaftsachsen Hautfarbe, Staatsbürgerschaft, Legalität, Geld, Bildung etc. zusammen. Das sehen wir als Chance, Stellvertreter_innenpolitik zu überwinden und zu einer verbindenden politischen Praxis zu gelangen. Es verlangt aber auch, bestimmte Selbstverständlichkeiten in der Arbeit linksradikaler Gruppen in Deutschland zu hinterfragen und praktisch umzugestalten. So etwa die (deutsche) Einsprachigkeit der Gruppenkommunikation, das Setzen von Themen und Aktionsformen aus privilegierter Perspektive und die De-Thematisierung von rassistischen Ausschließungsmechanismen innerhalb linker Gruppen. Auch der unterschiedliche Zugang zu Ressourcen aller Art führt häufig zu Ungleichgewichten in der politischen Arbeit. Raum für diese notwendigen Reflexionen zum einen in der AG und zum anderen auf der Ebene der Großgruppe FelS sowie weitergehend linksradikaler, antirassistischer Zusammenhänge in Berlin zu schaffen, sehen wir als eine Herausforderung. Zudem stoßen wir häufiger auf das Problem, mit Begriffen und dahinterstehenden Kategorien arbeiten zu müssen, die wir eigentlich ablehnen. Schon beim Verfassen dieses Absatzes beginnt der begriffliche Eiertanz, um einerseits den Diskriminierungserfahrungen einer heterogenen Gruppe von Menschen gerecht zu werden, und Privilegien sichtbar zu machen, andererseits diese diskriminierenden Kategorisierungen nicht zu reproduzieren.
Freies Fluten statt freie Märkte
Trotz dieser Widersprüchlichkeiten, die politisches Handeln unter den bestehenden Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnissen mit sich bringt, bleibt internationale Solidarität angesichts eines globalen kapitalistischen Systems notwendig. Ausdifferenziert wie das System, das wir überwinden wollen, muss auch unser Widerstand sein: Sei es zum Beispiel die Frage der Verteilung von Land in den Ländern des Globalen Südens zu stellen und sich gegen Land Grabbing, also die Enteignung von Kleinbäuer_innen durch Regierungen und Wirtschaftsunternehmen, zu wehren. Sei es, global agierende Konzerne für die Ausbeutung von Arbeiter_innen anzugreifen. Sei es, die Spekulation mit Nahrungsmitteln anzuprangern oder die militärische Absicherung von Rohstoffen und Handelswegen nicht hinnehmen zu wollen. In die Vielfalt dieses Widerstandes gehört auch, das Regime der Migrationskontrolle zu bekämpfen.
Ein Paradoxon des Kapitalismus liegt darin, Zustände zu produzieren, die für Millionen von Menschen die Ausbeutung in schlecht bezahlter Lohnarbeit in Ländern des Globalen Nordens als die beste aller schlechten Alternativen erscheinen lässt. So ist Migration doch immerhin ein Weg, sich Perspektivlosigkeit, Hunger und anderen unhaltbaren Zuständen in den Herkunftsländern zu entziehen. Die Wirtschaft in den Metropolen des Globalen Nordens profitiert von den billigen, weil entrechteten Arbeitskräften in informellen Arbeitsverhältnissen. Gleichzeitig stellt diese Migration die globale Ordnung in Frage, die den unkontrollierten Fluss von Waren und Kapital vorsieht, nicht aber die freie Bewegung von Menschen, die sich den gesellschaftlichen Verwerfungen dieser Ordnung entziehen wollen.
Daher muss die Bekämpfung des Migrationskontrollregimes auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene stattfinden. Dies ergibt sich schon aus dem Aufbau des Regimes selbst. Sei es die Lagerunterbringung in »Dschungelheimen«3 irgendwo in Brandenburg oder der Aufbau von Grenzüberwachung in EU-Anrainerstaaten mit Hilfe der EU-Grenzagentur Frontex. Wenn wir dabei das Wissen der Kämpfe im Globalen Süden nicht in unsere eigenen Praxen integrieren, wird es hierbei keine Fortschritte geben. Denn nur dann ist ein zeitgemäßer Internationalismus denkbar, der die bestehenden Verhältnisse überwinden kann.