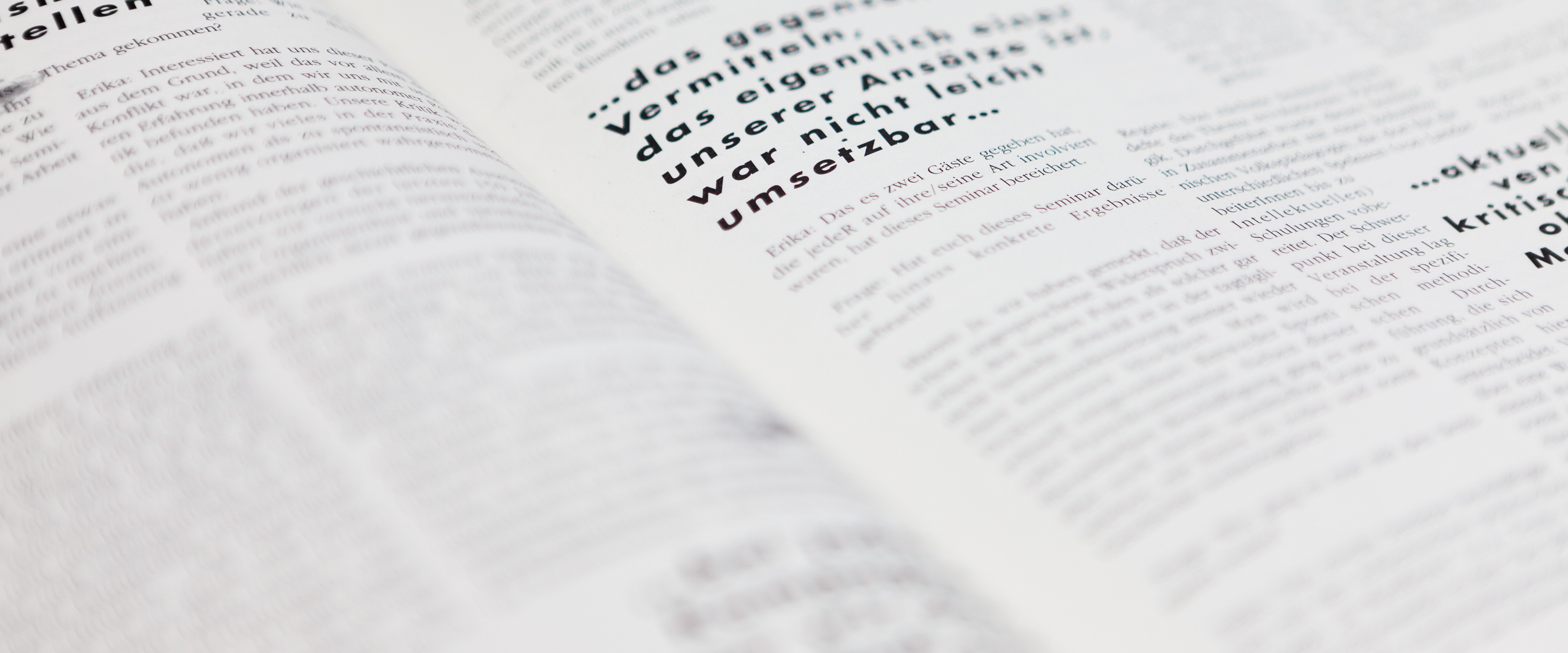FelS: ¿ Ihr bietet seit eineinhalb Jahren Seminare zu politisch-revolutionären Themen an. Wie habt ihr euch dazu entschlossen, Seminare zu einem Schwerpunkt eurer Arbeit zu machen?
Manni: Sicherlich ist dies eine etwas unübliche Praxisform und erinnert an den etwas fossilen Charakter von einigen K-Gruppen, Schulungen zu machen. Gerade in autonomen, linken Zusammenhängen herrscht diese Auffassung vor.
Regine: Unsere konkrete Erfahrung aus der politischen Praxis der letzten Jahre war, daß in der autonomen Bewegung Erfahrungen und Wissen nicht weitergegeben werden. Das heißt in der Konsequenz, jede Generation muß die gleichen Fehler neu machen, oder wie ein Altautonomer mal selbstkritisch zu mir sagte: Bei jeder Kampagne müssen wir das Rad neu erfinden ... Der Durchlauf der Autonomen ist so groß, daß praktisch alle eineinhalb Jahre neue Leute kommen und die Erfahrungen, die schon gemacht wurden, z.B., beim Organisieren von Volxküchen oder Demos nicht mehr weitergegeben werden. Altautonome – die wenigen, die schon lange dabei und inzwischen 35 bis 40 Jahre alt sind – versuchen nur in den allerwenigsten Fällen mit jüngeren Leuten gemeinsame Erfahrungen zu sammeln, womit also die Weitergabe und das Ansammeln und Formulieren von geschichtlichem Wissen und Erinnerungen gewährleistet wäre. Dass dies nicht stattfindet, ist einer der wichtigsten Gründe, warum die Linke hier seit Jahren auf der Stelle tritt.
¿ Was für Seminare habt ihr in den letzten anderthalb Jahren gemacht und wie haben sich die Inhalte der Seminare mit der Zeit verändert?
Erika: Angefangen haben wir mit einem Seminar, in dem wir versucht haben, den Organisierungsgedanken dem Spontaneismus gegenüberzustellen.
„… haben wir versucht herauszufinden, ob sich Organisiertheit und Spontaneismus tatsächlich derart gegenüberstehen müssen.“
¿ Wie seid ihr gerade zu diesem Thema gekommen?
Erika: Interessiert hat uns dieser Punkt aus dem Grund, weil das vor allem der Konflikt war, in dem wir uns mit unseren Erfahrung innerhalb autonomer Politik befunden haben. Unsere Kritik war die, daß wir vieles in der Praxis der Autonomen als zu spontaneistisch und zu wenig organisiert wahrgenommen haben.
Anhand der geschichtlichen Auseinandersetzungen der letzten 150 Jahre haben wir versucht herauszufinden, ob sich Organisiertheit und Spontaneismus tatsächlich derart gegenüberstehen müssen.
In diesem Seminar haben wir uns anfangs mit Texten von Marx und Bakunin beschäftigt. Über Bakunin wußten damals viele von uns noch nicht, daß er trotz seiner nach außen libertären Ideen Mitglied einer hierachischen Geheimorganisation war.
Dies also in einer Zeit der sich entwickelnden linksradikalen Ideologie. Außerdem sprachen wir lange mit einer Übersetzerin von Lenin über seine Texte, in denen er das Modell der kommunistischen Partei entwickelte und entdeckten viel aktuelles an seinem Text „Linksradikalismus, die Kinderkrankheit im Kommunismus“ und lasen Luxemburg, die ihn schon früh kritisierte. Das stellvertretend für eine Epoche, die den Scheidepunkt hin zu der Ergreifung einer Gegenmacht und damit konkret praktischer Politik darstellte. Zum anderen ging es um einen Rückblick in die siebziger Jahre und die Frage, in welcher Form sich da organisierte (K-Gruppen) und spontaneistische Ansätze gegenübergestanden haben.
¿ Nach welcher Methode seid ihr vorgegangen?
Regine: Nach einem Einführungsreferat über die Siebziger hat uns ein Zeitzeuge seine Erfahrungen erst aus einer K-Gruppe und dann innerhalb der Spontibewegung geschildert. Danach haben wir uns in zwei Arbeitsgruppen aufgeteilt, die auch Parallelen zu den erwähnten Klassikern sahen.
Erika: Dass es zwei Gäste gegeben hat, die jedeR auf ihre/seine Art involviert waren, hat dieses Seminar bereichert.
¿ Hat euch dieses Seminar darüber hinaus konkrete Ergebnisse gebracht?
Manni: Ja, wir haben gemerkt, daß der schon angesprochene Widerspruch zwischen den beiden Polen als solcher gar nicht besteht; obwohl er in der tagtäglichen Auseiandersetzung immer wieder Diskussionen blockiert. Man wird schnell eingeordnet: Entweder Sponti oder Parteikommunist. Neben dieser theoretischen Beschäftigung ging es uns aber auch darum, unmittelbar Leute zu erleben, mit ihnen zu reden und somit Geschichte weiterzugeben.
„… aktuelle Alternativen linker Politik kritisch aufzuzeigen, ohne immer in die Mottenkiste zu greifen.“
¿ Wie ging es nun mit den Seminaren weiter?
Erika: Das zweite Seminar beschäftigte sich mit der italienischen politischen Gruppe „Il Manifesto“ (u.a. Texte von Rossana Rossanda) in den 70er Jahren in Italien. Die Auseinandersetzung mit dieser Gruppe war uns deswegen wichtig, weil sie – zu ihrer Zeit und natürlich in einer anderen Größenordnung – wie wir meinen, einen unserem Versuch ähnlichen Weg eingeschlagen haben. Entstanden ist sie aus der Abspaltung von der italienischen KP, jedoch ohne ihre Vergangenheit völlig abzulehnen und ihr Konzept sah so aus, einen fruchtbaren Mittelweg zwischen KP und autonomer Bewegung in Italien zu finden.
Manni: Dieser Gedanke durchzieht eigentlich auch das dritte Seminar. Es ist die Beschäftigung mit zwei nicht traditionellen KP-Linken in Europa, nämlich einmal die Koordination KAS aus dem Baskenland und darüberhinaus mit der „Neuen Linken Strömung“ aus Griechenland. Zustande gekommen ist dieses Seminar auch deswegen, weil es sowohl persönliche Kontakte zu diesen beiden Gruppen gab und deshalb leicht möglich war, aktuelle Alternativen linker Politik kritisch aufzuzeigen, ohne immer in die Mottenkiste zu greifen.
Regine: Das nächste Seminar behandelte das Thema revolutionäre Pädagogik. Durchgeführt wurde dieses Seminar in Zusammenarbeit mit einer kolumbianischen Volkspädagogin, die dort für die unterschiedlichen Spektren (von LandarbeiterInnen bis zu Intellektuellen) Schulungen vorbereitet. Der Schwerpunkt bei dieser Veranstaltung lag bei der spezifischen methodischen Durchführung, die sich grundsätzlich von Konzepten hier unterscheidet: Viele der Seminare liefen über eine Woche, an deren Anfang erst einmal stand, sich kennenzulernen und somit auf persönlich sehr unterschiedlichen Ausgangsbedingungen für die TeilnehmerInnen einzugehen. Wir merkten, daß die Themen aus der dortigen Situation heraus ganz anders aufgearbeitet werden müssen und staunten über die intensive Vor- und Nachbereitung, zum Teil auch mit TeilnehmerInnen.
„Das gegenseitige Vermitteln, das eigentlich einer unserer Ansätze ist, war so nicht leicht umsetzbar.“
¿ Wie waren die Erfahrungen für eure Gruppe nach den ersten Seminaren?
Regine: Wir haben Seminare angeboten, wo die Leute unabhängig von den Gründen ihres Interesses und der bisherigen Intensität ihrer Beschäftigung mit den Themen kommen konnten. Wenn wir uns dann in kleinere Gruppen von fünf oder sechs Leuten aufgeteilt haben, war es immer noch schwierig. Die Bereitschaft ohne Arroganz sein Wissen zur Verfügung zu stellen statt damit anzugeben oder sich abzugrenzen war nur teilweise vorhanden, oder einige waren einfach nicht in der Lage, es mit einfachen Worten darzustellen. Zum anderen hatten die, die wenig zu dem Thema wußten, Hemmungen, den Verlauf der Seminare dadurch mitzugestalten, daß sie sagten, wenn es zu schnell gegangen, ist und ihre Fragen formulierten. Das gegenseitige Vermitteln, das eigentlich einer unserer Ansätze ist, war so nicht leicht umsetzbar.
Erika: Das Seminar der Kolumbianerin war auch eine Anregung für unsere Praxis, denn sie sagte, sie würde Seminare für unterschiedliche „Wissensstände“ machen.
¿ Inwiefern habt ihr die Methodik der Seminare dann geändert?
Regine: Wir haben gesehen, daß es wichtig ist, Seminare speziell für die Leute zu machen, die kein großes politisches Vorwissen mitbringen, die viele Fragen haben und die Antworten gemeinsam erarbeiten wollen. Da gab es zweierlei: die Idee, eine ganze Seminarreihe einmal im Monat über ein halbes Jahr zur politischen Ökonomie machen, von einem Uni-Dozenten veranstaltet, der auch schon im Bildungsbereich von Gewerkschaften tätig war. Da wollten wir grundsätzliche Fragen klären. Zum anderen haben wir alle zwei Wochen donnerstags ein Treffen gemacht, das noch weiter „unten“ ansetzen sollte. Ausgehend von dem bereits vorhandenen Wissen, sei es aus der Schule, sei es angelesen, wollten wir ohne große Vorbereitung in lockerer Atmosphäre zu Themen der Geschichte erzählen können, was wir wissen. Die Themen orientierten sich an einer Art Geschichte des Widerstands, es ging aber auch z.B. über die Herausbildung der Städte oder den Übergang vom Matriarchat zum Patriarchat. Da sind wieder ganz andere Leute gekommen. Außerdem versuchte eine andere Gruppe die Erfahrungen aus unserem Seminar zum 3:1 Text von Viehmann und anderen zusammenzufassen.
¿ Wie laufen zur Zeit eure Seminare?
Manni: Es soll eine Seminarreihe über Ost-Europa geben. Ansonsten läuft die Seminarreihe über politische Ökonomie nach wie vor. Da kommen auch jedesmal an die 15 bis 20 Leute, die nicht zu Fels gehören relativ kontinuierlich. Der Lerndonnerstag wird umstrukturiert, obwohl es stellenweise spannend war, in der Geschichte zu graben. Wir hatten Schwierigkeiten, den Bezug zu heute herzustellen. Daraus wird ein wöchentliches Treffen, auf dem über aktuelle Themen, die in der Presse auffallen, geredet werden soll, z. B. was der Solidarpakt für uns bedeutet, was mit den „Metallern“ ist und so weiter.
Erika: Dieses Donnerstagstreffen, wie auch die neue Seminarreihe, resultiert aus einer grundsätzlichen Überlegung: Jede politische Gruppe, die offen ist, muß sich mit dem Widerspruch konfrontieren, daß „erfahrenere“ und „unerfahrenere“ Leute zusammenkommen und es nicht die Lösung sein kann, daß die „erfahreneren“ unter sich bleiben, sondern es darum gehen muß, daß es zum Dialog der unterschiedlichen Menschen kommt. In jedem Handwerk wird als normal empfunden, daß der Meister dem Lehrling erklärt, wie’s geht. Die Probleme tauchen auch hier erst bei der Art der Wissensvermittlung auf. Der „Oberchecker“ soll nicht dem Lernenden die Dinge einpauken, sondern es geht um einen allmählichen Prozeß, in dem sich der Lernende selbst entdeckt und seine Meinung Stück für Stück entwickelt. Ebenso langwierig und prozeßhaft ist natürlich auch die konkrete Umsetzung dieses Anspruchs.
Manni: Das spiegelte sich auch in unserer Gruppe wieder. Bisher hatten wir eine Art Klüngel an Leuten, die länger aktiv sind und auch den Überblick über die Gruppe behalten. Wir finden es aber wichtig, daß diese. koordinierenden Aufgaben verteilt werden und nicht in den Händen von denen bleiben, die das schon immer machen. Die Planungsgruppe von drei bis vier Leuten übernimmt die Koordination und rotiert, so daß gewährleistet wird, daß jedEr in der Gruppe sich abwechselnd in der Situation befindet, eine aktive Rolle zu haben. Das wird vor allem dann interessant, wenn viele neue Leute hinzukommen.
Regine: Genau, daran liegt es auch, daß die Planungsgruppe immer wieder einschläft. Seit längerer Zeit sind kaum Leute dazugekommen und die, die schon lange dabei sind, können schnell koordinieren und treffen daher eher die Entscheidungen. Jemand, der außerhalb von diesem Kreis ist und nur zu manchen Terminen kommt, kriegt vieles einfach nicht mit. Wir müssen aufpassen, daß der Kreis nicht noch geschlossener wird und Neue schwer einen Zugang finden.
Erika: Das so etwas nicht passiert, wäre ja eigentlich die Aufgabe der Planungsgruppe: Mit etwas Abstand ein Auge darauf zu haben, in welche Richtung sich was entwickelt und wo andere Punkte verloren gehen.
Manni: Das Problem wäre nur dadurch zu lösen, daß sich alle gleich oft sehen und sich gleich stark in der Gruppe engagieren. Sonst müßte man den Aktiveren verbieten, mehr als drei mal die Woche etwas zu machen und den Passiveren müßte man es vorschreiben. Aber wir wollen ja gerade möglich machen unterschiedliche Menschen mit mehr oder weniger Zeit eine Mitarbeit zu ermöglichen. Auch die Unfähigkeit hierzu hatten wir ja autonomen Strukturen hier in Berlin vorgeworfenen. Das Problem läßt sich nicht endgültig lösen. Wir können uns immer nur korrigieren. Da ist die Planungsgruppe sicherlich ein richtiger Schritt. Lernprozesse erreichen nie ein Idealbild, sondern können immer nur neue Anstöße geben, damit man nicht bequem wird und sich mit einem Zustand abfindet.
„Wir erreichen nicht viel, wenn wir moralische Appelle formulieren, sondern wenn wir die Konflikte durchleben und uns gegenseitig kritisieren.“
¿ Ist da nicht ein Widerspruch: auf der einen Seite stellt ihr ein klares Seminarkonzept auf und andererseits scheint aber innerhalb der Gruppe ein klares Ziel, an dem ihr euch orientiert, zu fehlen. Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang Selbstschulung für euch?
Erika: Einen solchen Widerspruch sehe ich nicht. In der Gruppe ist der Versuch nur praktischer, konkreter. Auf dem Seminar hingegen, selbst wenn es ein halbes Jahr läuft und die Leute vielleicht kontinuierlich kommen, kannst du nicht immer verfolgen, was es tatsächlich bei ihnen bewirkt und welche Konsequenzen sie daraus ziehen. In der Gruppe kommen die Schwierigkeiten, die ein Lernprozeß mit sich bringt, mehr zum tragen: Allein der Anspruch, Verantwortung zu übernehmen, reicht nicht aus. Oft ist es schwerer als man glaubt, übernommene Aufgaben auch konsequent durchzuführen. Der Unterschied zu den Seminaren ist die Eigendynamik, der die Gruppe unterliegt. Es geht um einen sozialen Lernprozeß, der sich weniger auf einer Erkenntnis als vielmehr auf einer persönlichen Ebene abspielt. Somit sind Konflikte und Schwierigkeiten nicht unbedingt ein Anzeichen dafür, daß die Gruppe nicht funktioniert. Wir erreichen nicht viel, wenn wir moralische Appelle formulieren, sondern wenn wir die Konflikte durchleben und uns gegenseitig kritisieren. Andererseits kann ein Seminar diese Art von Lernen mit beeinflussen. Wir versuchen jetzt neuen Leuten einen Einstieg über das praktiktische Mitwirken zu ermöglichen, wie gesagt über die Seminare oder durch die Teilnahme an der Zeitung. Wir haben zwar ein offenes Plenum, aber wenn technische Dinge geklärt werden, entsteht bei den Leuten schnell der Eindruck, nichts beitragen zu können, was bei inhaltlichen Diskussionen anders ist. Deshalb laden wir neue Leute auch immer dazu ein, eine Stunde vor Beginn zu kommen, um dann in Ruhe erstmal alle Fragen beantworten und sich beschnuppern zu können.
¿ Nochmal zu den Seminaren: Werdet ihr nicht zu einer Volkshochschule oder anders ausgedrückt zu einem Dienstleistungsunternehmen, wenn die Leute eure Seminare zwar „konsumieren“, sich sonst aber an der Arbeit der Gruppe nicht beteiligen?
Manni: Bisher bestimmt nicht. Das wäre so, wenn sich unsere Arbeit auf das Veranstalten von Seminaren beschränken würde. Wir wollen Denkanstöße geben, sich kritisch mit seiner Realität auseinanderzusetzen und Möglichkeiten, Widerstand zu leisten, entwickeln. Wie und ob die Leute dann aktiv werden, liegt erstmal bei ihnen selbst. Wir bieten ihnen an, auch an anderen Fels-Projekten teilzunehmen, setzen dies aber nicht voraus. Niemand fühlt sich gern vereinnahmt oder rekrutiert. Natürlich wünschen wir uns Verbindlichkeit, wollen diese aber auch niemandem aufzwingen. Dabei lassen wir uns auf eine Gratwanderung ein.
„Erstmal lehren Menschen oft, wie sie selbst gelernt haben.“
¿ Habt ihr in den eineinhalb Jahren Arbeit objektive Kriterien gefunden, wo Selbstschulungsprozesse an Grenzen stoßen?
Erika: Bei jüngeren Leuten, die vielleicht noch in der Schule sind ist es oft schwer, ein Interesse an Selbstschulung zu wecken, weil „lernen“ und „Schulung“ zum großen Teil negativ besetzt sind. Schule wird mit vorgegebenen Inhalten, die mit der persönlichen Situation der Lernenden nichts zu tun haben, assoziiert. Außerdem kommt der Aufwand an Zeit hinzu, der dafür notwendig ist.
Ein weiterer Punkt ist sicherlich, daß man in gewissen Fragen über ein Halbwissen verfügt, mit dem man sich zufrieden gibt. Erst wenn man es vertieft und ausbaut, werden größere Zusammenhänge deutlich. Oftmals bemüht man sich nicht, sich weiterzuentwickeln, um vielleicht alte Positionen zu verlassen oder zu anderen Konzepten zu kommen. Ein anderer Grund für diese Barriere ist, daß die Bevölkerungsmehrheit eher intellektuell gefordert ist und zusätzlicher „Beanspruchung“ abwehrend gegenüber steht. Hinzu kommt, daß beim Lernprozeß bevormundende Verhaltensmuster reproduziert werden, mit denen man sich nicht identifiziert und die man für sich ablehnt, da Situationen aufkommen können, die einem vom Umgang mit Autoritäten, wie Lehrer oder Eltern, bekannt sind. Auch die permanente Reizüberflutung, der wir ausgesetzt sind, spielt eine Rolle. Daher müssen wir das Vermitteln von Wissen lebendig gestalten, indem es in Bezug zur eigenen Person gesetzt wird. So kann sogar an sich trockene Theorie für einen selbst wichtig werden, wenn klar wird, welchen Hintergrund und Tragweite sie hat. So weit sind wir noch lange nicht. Uns fehlt dabei oft die Kreativität und die Idee, wie theoretisches Wissen praktisch vermittelt werden kann. Stattdessen sind wir viel zu oft in konventionelle Lernformen zurückgefallen. Erstmal lehren Menschen oft, wie sie selbst gelernt haben. Das müssen wir noch stärker in Frage ziehen.
¿ Was ihr von eurer Arbeit berichtet, klingt erst einmal sehr theoretisch. Wo hat eure Arbeit denn den konkreten Bezug zu eurer Praxis innerhalb der Gruppe und zu Gruppen, mit denen ihr zusammenarbeitet?
Erika: Unsere Arbeit ist insofern Praxis, als sie ja eine organisierende Wirkung anstrebt. Ziel eines revolutionären Prozesses ist ja nicht nur, daß du in den Schlagzeilen erscheinst, sondern daß auch mehr Leute dazu kommen, sich über ihre Situation bewußt werden und anfangen, sich in einer Gruppe sozial zurechtzufinden. Was kann die Linke im Moment mehr machen als für die Zukunft zu bauen und erkämpfte Errungenschaften zu verteidigen? Solch eine Arbeit ist ein Teil, ich würde nicht behaupten, daß es der wichtigste ist und alles andere Quatsch ist oder inhaltslos. Andererseits raubt uns die Arbeit so viel Kraft, daß wir, wenn uns andere Gruppen auf Mobilisierung ansprechen, oft sagen müssen, finden wir zwar gut, wir haben aber an dem Tag schon fünf Treffen. Mit dieser neuen Orientierung haben wir uns den Vorwurf eingeheimst, eine Labertruppe zu sein. Außerdem sind viele von uns noch unabhängig von Fels in anderen Gruppen aktiv.
¿ Glaubt Ihr, daß eure Art der Arbeit in dem Gesamtprozeß einer revolutionären Linken innerhalb der BRD und international Perspektiven hat?
Erika: (...lacht) ...na so wichtig ist unser kleiner Haufen nun nicht ... aber die Veränderungen, die innerhalb des Zusammenbruchs des Sozialismus stattfanden, haben eine ganze Menge an Vorstellungen und Utopien von einer. anderen Gesellschaft zerstört. Es ist ja nicht so, daß nur die kommunistischen Parteien von dem was geschehen ist, betroffen sind, sondern die Linke insgesamt. Wenn wir eine nicht kapitalistisch und nicht patriarchale Gesellschaft wieder vorstellbar machen wollen, müssen wir auch Entwürfe entwickeln. können. Wir finden es wichtig, sich in der Geschichte auszukennen, um sagen zu können, hier stimmen wir überein und da unterscheiden wir uns, und an diesem Problem sind verschiedene Ansätze gescheitert oder eingemacht worden, um selber wieder ein Bild zu gewinnen, von dem, wo wir hin wollen. Natürlich ist nicht nur das Wissen um die verschiedenen Theorieansätze von zentraler Bedeutung, aber wir als Gruppe haben hier erstmal eine Priorität gesetzt. In Zukunft hoffen wir natürlich auch mehr „praktische“ Arbeit im engeren Sinn zu machen.