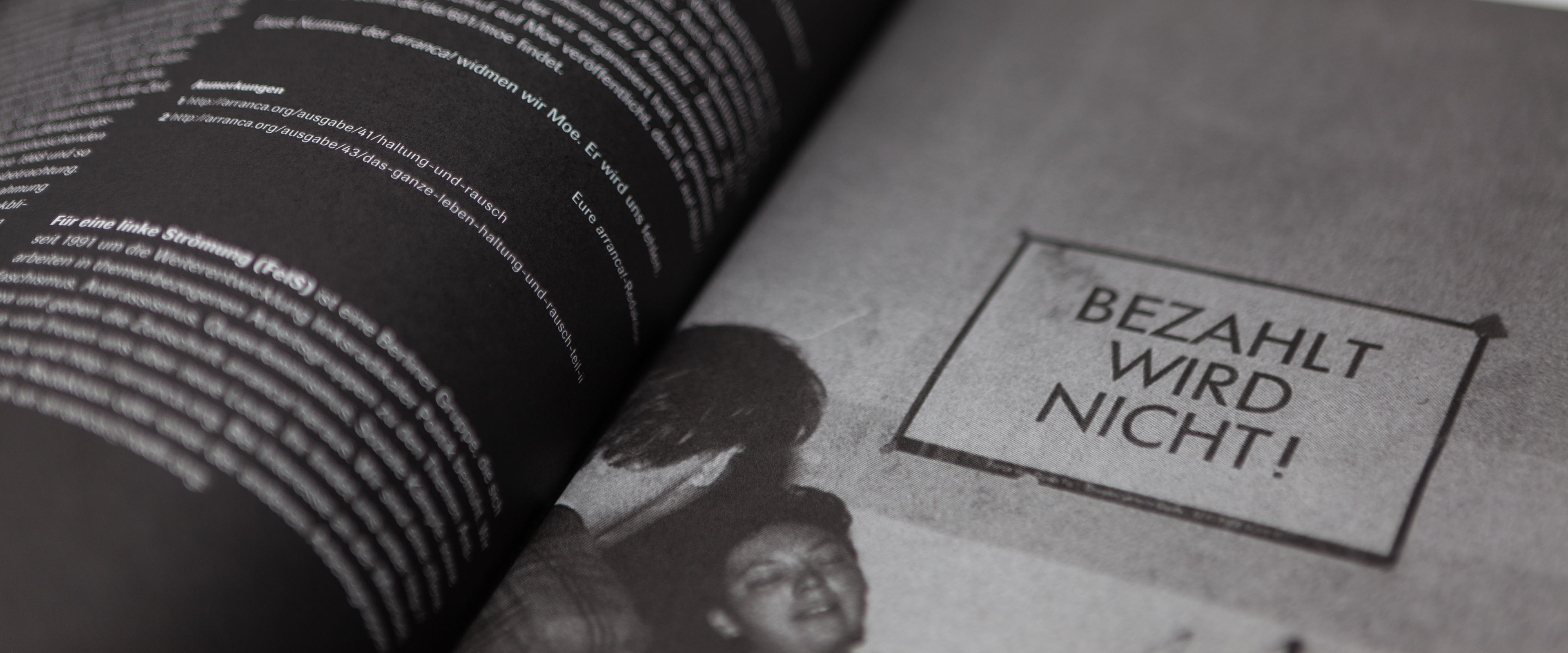20 Jahre FelS. Erzählen wie wir gewesen sein wollen und wie wir erinnert werden können
In diesem Sommer gibt es FelS nun ziemlich genau zwei Jahrzehnte – eine lange Zeit. Doch die wenigsten heute bei FelS Aktiven waren von Anfang an dabei. Die meisten haben vor 20 Jahren noch in den Kinderschuhen gesteckt. Was uns als FelS heute verbindet, ist für die Einen vage und für Andere ganz klar. Dieser Umstand geht nicht zuletzt auf das zurück, was den nicht minder vagen Titel ‚postautonom‘ trägt.
Was also heißt postautonom? Die Vorsilbe „post“ allein trägt zur Begriffsbestimmung nicht viel bei. Dass bisher niemandem ein „eigener“ Name für diese Generation der radikalen Linken eingefallen ist, mag auch daran liegen, dass schon die Bezeichnung „Autonome“ stets sehr vage war. Glaubt man den Jugendforscher_innen an den Unis oder den deutschen Mainstream-Medien, so genügen ja schon ein schwarzer Kapuzenpullover, ein Pflasterstein und eine Portion diffuser Wut im Bauch, um sich als Autonome_r zu qualifizieren. Derlei Platitüden werden von den meisten Autonomen zwar entschieden zurückgewiesen, auch innerhalb der Bewegung hat sich aber nie eine gemeinsame (Selbst-)Bezeichnung durchgesetzt. Um sich dem Begriff und seiner Bedeutung zu nähern, ist es hilfreich in der Geschichte zu graben.
Von Autos und Postautos
Zwar reichen die Wurzeln dieser undogmatischen linksradikalen Strömung bis zu den rätekommunistischen und anarchosyndikalistischen Bewegungen des frühen 20. Jahrhunderts zurück, der wichtigste Bezugspunkt der autonomen Bewegung dürfte aber die italienische Linke der 1960er Jahre darstellen. Dort stand der Begriff der Autonomia zunächst zum Einen für die Emanzipation der Anfang des Jahrzehnts entstandenen neuen linksradikalen Bewegung Italiens von der moskautreuen kommunistischen Partei und ihrem staatstragenden Reformkurs. Zum Anderen verwies er auf den Operaismus, der marxistischen Schule dieser Neuen Linken und seinen Fokus auf die spontanen Arbeitskämpfe der norditalienischen Automobilindustrie, vom „unsichtbaren“ Alltagswiderstand krank feiernder und bummelnder Fließbandarbeiter_innen bis hin zum wilden Streik in der Fabrik. Aus diesen Kämpfen leiteten die italienischen Genoss_innen ein Geschichtsverständnis ab, dasnicht den Tarifrunden und Wahlkämpfen der institutionalisierten Arbeiter_innenbewegung die entscheidende Rolle in der Geschichte des Kapitalismus beimaß. Ihre Begeisterung galt dem weitgehend spontanen und unberechenbaren autonomen Widerstand der Arbeiter_innen selbst, der sich der Kontrolle durch Partei und Gewerkschaft entzog.
In Deutschland wurde der Begriff nie wirklich einheitlich verwendet. Anhänger_innen der operaistischen Ideen wie etwa die Frankfurter Gruppe „Revolutionärer Kampf“ oder die Münchner „Arbeitersache“ versuchten zwar bereits in den 1970er Jahren mit einigem Erfolg, auch in Deutschland eine politische Praxis nach italienischem Vorbild zu etablieren, doch mit dem Bruch der linken Bewegung Ende der 1970er Jahre ging davon viel verloren. Zwar griffen auch in den 1980ern immer wieder Teile der autonomen Szene auf das operaistische Ideengebäude zurück, beispielsweise die Jobber_innenbewegung oder die Autor_innen der Zeitschriften „Wildcat“ oder „Autonomie Neue Folge“. Als sich aber Anfang der 1980er Jahre relativ plötzlich massenhaft linke Jugendliche ohne gemeinsame Organisation oder einheitliches Weltbild als Autonome zu bezeichnen begannen, galten die operaistischen Politikansätze als kaum minder suspekt als die dogmatisch erstarrte Praxis der maoistischen K-Gruppen, die noch wenige Jahre zuvor das linksradikale Spektrum der BRD dominiert hatten. Die zweite Generation der Autonomen wuchs durch die Welle von Hausbesetzungen Anfang der 1980er binnen weniger Monate fast aus dem Nichts zu einer bedeutenden sozialen Bewegung, die während des gesamten nächsten Jahrzehnts von AKW bis Volkszählung bei fast jedem politischen Protestereignis in der BRD mitmischte. Doch trotz zahlloser Versuche von Staat und Medien, die Autonomen als Krawallchaot_innen zu brandmarken, gelang es bis zum Fall der Mauer nicht, sie vom Rest der Neuen Sozialen Bewegungen politisch zu isolieren.
Durch den Bruch mit dem Avantgardeanspruch der K-Gruppen und mit der Weiterverbreitung des „Triple Opression“ -Ansatzes ab Mitte der 1990er Jahre, der mit der Analyse von mehreren sich gegenseitig beeinflussenden Unterdrückungsmechanismen (Rassismus, Sexismus, Klassismus) eine Abkehr vom Hauptwiderspruchsdenken darstellte, leisteten sie einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung eines undogmatischen linken Politikverständnisses – und das trotz ihrem weitgehenden Desinteresse an linker Theorie.
Für eine szeneweite Debatte über die eigene Geschichte fehlte der Raum. Während die Erfahrungen aus dem italienischen Klassenkampf und die operaistische Theorie bei FelS ein Jahrzehnt später auf großes Interesse stießen, ging es der „Generation Weserstadion“ bei ihrer Autonomie in erster Linie um Unabhängigkeit von den (Alltags-)Zwängen der Industriegesellschaft. Das brachte nicht nur die radikale Ablehnung der Lohnarbeits-und-Hausfrauen-Lebensläufe der eigenen Elterngeneration mit sich. Das Wissen um die schlechten Erfahrungen mit linken Organisationsversuchen der 1970er und die fehlende linksradikale Perspektive der realsozialistischen Projekte bedingte einen radikalen Bruch mit allem, was den Organisationsformen der K-Gruppen der 1970er Jahre nur entfernt ähnlich sah.
Es sollte dieses Desinteresse an einem verbindlichen Organisierungssansatz sein, das Ende der 1980er Jahre für große Unzufriedenheit bei vielen Autonomen sorgte. Vor allem die Fixierung der Bewegung auf Großkampagnen gegen Gipfeltreffen (etwa den Reagan-Besuch oder das IWF-/Weltbanktreffen Ende der 1980er in Berlin ), wurde von Teilen der Szene immer schärfer kritisiert. Die Bewegung fiel nach dem Ende einer solchen Kampagne stets wieder auf ihre Ausgangs-situation als selbstreferentielle, unverbindliche und nur anlassbezogen vernetzte Szene zurück. Im Zuge einer später unter dem Namen „Heinz Schenk Debatte“ bekannt gewordenen Diskussion zum Zustand der autonomen Szene Berlins in der Zeitschrift Interim Anfang der 1990er wurde dieser Status Quo von späteren FelS-Gründungsmitgliedern scharf kritisiert, vor allem mit dem Textbeitrag „Ich bin doch kein Kampagnenheinz!“. Darin hieß es, die autonome Bewegung sei theoriefeindlich, unorganisiert, planlos und unfähig, über die rein szeneinterne Großevent-Mobilisierung hinaus irgendeine nachhaltige linke Politik auf die Beine zu stellen.
Es dürfte nicht zuletzt der teilweise beißenden Polemik dieser Texte geschuldet sein, dass „postautonom“ in den Ohren vieler Linker bis heute genauso klingt wie „anti-autonom“. Angesichts der zahlreichen kleinen und großen Streitigkeiten, die das Verhältnis zwischen autonomer Szene einerseits und postautonomen Gruppen wie Avanti, Antifa [M] oder FelS andererseits in den letzten 20 Jahren mit geprägt haben, mag das teilweise stimmen, greift aber zu kurz. Denn wenn man den Beginn der postautonomen Gruppen auf die Heinz-Schenk-Debatte reduziert, vergisst man, dass beispielsweise FelS die autonome Kritik am dogmatischen Marxismus-Leninismus der 1970er Jahre von Anfang an teilte. Der Schritt „weg von den Autonomen“ war nicht einfach ein Schritt zurück zur K-Gruppen-Politik. Die autonome Ablehnung des leninistischen Avantgarde-Selbstverständnisses, der „Hauptwiderspruchs“-Logik oder der Stellvertreter-Praxis der Werkstor-Agitation stellt ein ebenso kennzeichnendes Moment des postautonomen Selbstverständnisses dar wie die Kritik an der auf die eigene Szene beschränkten Kampagnenpolitik der Autonomen. Die für die FelS-Gründung nicht minder bedeutsamen 38 Thesen für eine Neukonstituierung der Linken aus der 1993 erschienenen ersten arranca!-Ausgabe greifen diese Punkte auf und setzen sich darüber hinaus auch intensiv mit dem schweren Erbe des kurz zuvor gescheiterten, erstarrten sozialistischen Modells nach sowjetischem Vorbild auseinander.
Seitdem beschäftigen FelS und andere Gruppen die damals formulierten Ansprüche an die eigene Politik, vor allem die Organisationsfrage. Die mittlerweile in ganz Nordwestdeutschland und Berlin aktive Gruppe Avanti existiert seit 22 Jahren und andere große postautonome Gruppen wie etwa die Organisierte Autonomie aus Nürnberg, die Antifaschistische Aktion Berlin oder die Antifa [M] aus Göttingen haben sich zwar mittlerweile gespalten, ihre Nachfolgeorganisationen spielen aber bis heute bundesweit eine wichtige Rolle in der Linken.
Überlandfahrt statt Stadtverkehr
Weil der gemeinsame Anspruch, sich zu organisieren, von Anfang an auch überregional gedacht war, wurde schon Anfang der 1990er versucht, diese Gruppen über die Stadtgrenzen hinaus zu vernetzen. Während der erste Versuch, die Initiative Linke Organisierung (ILO), noch stark vom Bedürfnis nach einem einheitlichen Welterklärungsansatz geprägt war und bald am Unvermögen der Beteiligten scheiterte, eine theoretische Einigung zu erzielen, brach der Versuch einer bundesweiten Antifa-Organisation (AA/BO) erst im Jahr 2000 ganz auseinander. FelS hatte sich aus der AA/BO allerdings schon früher verabschiedet und mit dem Austrittspapier für Aufsehen in der deutschen Antifa-Szene gesorgt. Kritisiert wurde dabei vor allem, dass Antifapolitik in der AA/BO nie über bloße Anti-Nazi-Politik hinaus kam. Auch die vielen inhaltlichen Leerstellen wurden bemängelt, vor allem das in der AA/BO dominierende Geschichtsverständnis, nach dem der Faschismus nur eine besonders aggressive Form kapitalistischer Herrschaft darstellt.
„Richtig gerne erinnere ich mich an die ersten Euromaydays - damals war ich noch nicht bei FelS und weiß noch, dass ich sehr begeistert war, dass es eine linksradikale Gruppe gibt, die auch ohne (dominanten) Dresscode und ohne dieses martialische Auftreten am 1. Mai auf die Straße ging.“
Nach ILO und AA/BO wurde das Projekt einer bundesweiten Organisierung einige Jahre lang zurückgestellt und erst Ende der 1990er mit einem „Beratungstreffen“ verschiedener postautonomer Zusammenhänge und Einzelpersonen, aus dem später die Interventionistische Linke (IL) entstehen sollte, recht zaghaft wieder aufgenommen.
Schulterblick und toter Winkel
Auch wenn insbesondere seit den 1990er Jahren langfristige Organisierung im Zentrum der Auseinandersetzungen stand, war dies weder Selbstzweck noch das einzige Ziel. Was FelS betrifft, so geben bereits die „38 Thesen“ Aufschluss darüber, was zur Zeit der Gründung der Gruppe angedacht gewesen war. Die am Ende des Textes noch einmal auf „4 Kriterien“ zusammengefassten Kernthesen dieses Manifestes lauten wörtlich:
- linke Politik muss stärker versuchen, gesellschaftliche Isolation zu durchbrechen und sich an die Öffentlichkeit, an die anderen hier lebenden Menschen zu richten
- die organisatorischen Strukturen müssen soziale Lernprozesse fördern und die Einbindung neuer Menschen ermöglichen
- ein [...] technologiekritischer, nicht technologiefeindlicher Standpunkt
- das strategische Ziel, Selbstregierungsformen aufzubauen, d.h Macht nicht als Organisation oder Bewegung zu monopolisieren, sondern zu sozialisieren
Diese Thesen eignen sich, um ansatzweise zu beschreiben, was seit der Gründung von FelS alles geschehen ist und um zu überprüfen, inwieweit wir unseren vor 20 Jahren formulierten Ansprüchen gerecht werden.
Die Einbindung neuer Mitglieder ist in einer linken Gruppe oft schwierig. Viele Gruppen ziehen schon auf Grund des ungebrochen großen Interesses der deutschen Repressionsorgane an linker Politik die Klandestinität vor und finden ihre Neuzugänge nur im engsten politischen und persönlichen Umfeld. Wieder andere legen zwar großen Wert auf Offenheit und bemühen sich ständig um neue Mitstreiter_innen, stellen sich jedoch durch schwer verständliche Sprache und szene-interne kulturelle Codes immer wieder selbst ein Bein. Nichts Anderes gilt für die Geschlechterzusammensetzung oder für die krasse Dominanz von Weißen in vielen Gruppen.
FelS hat sich tatsächlich schnell zu einer relativ offenen Gruppe entwickelt und versucht, „Neuen“ den Anschluss an die politischen Diskussionen der mittlerweile sechs Arbeitsgruppen zu ermöglichen. Zwar ist es uns nicht gelungen, Wissenshierarchien ganz abzubauen, aber wir arbeiten daran. Dazu gehört nicht nur der Versuch, sich Theorie gemeinsam in Lesekreisen anzueignen, sondern auch das Handwerkszeug der politischen Praxis untereinander weiterzugeben und Workshops zu Themen wie Pressearbeit oder Webseitenadministration zu organisieren. Was kulturelle Codes angeht, so kann man zwar festhalten, dass es bei FelS keine Dresscodes gibt, also weder Nietengürtel- noch Windbreaker-Pflicht. Die Tatsache, dass sich die Gruppe vor allem aus Weißen Akademiker_innen zusammensetzt, spricht dennoch dafür, dass linke Politik immer noch eine sehr begrenzte Veranstaltung ist. Was das Geschlechterverhältnis betrifft, so wurde in der Geschichte der Gruppe schon zweimal versucht die Notbremse des „Aufnahmestopps für Männer“ zu ziehen, was man getrost als Verzweiflungstat bezeichnen kann.
Seit der FelS Gründung 1991, gab es immer wieder Versuche, Feminismus und Antikapitalismus zu verbinden. Die Arbeitsgruppen, die sich dieser Aufgabe widmen wollten, haben leider nie lange bestanden. Auch der Versuch, Geschlechterverhältnisse als Querschnittsthema innerhalb der konkreten Arbeit der anderen AGs zu bearbeiten, führte dazu, dass die internen Strukturen der Gruppe unter Gender-Gesichtspunkten beleuchtet wurden. Der Versuch, das Thema (Queer-)Feminismus in den Kontext der übrigen gesamtgesellschaftlichen Analysen und der konkreten Auseinandersetzungen der FelS-Praxis zu integrieren, scheiterte dagegen oft. Weil es damit nicht getan sein kann, haben wir Anfang 2010 die AG Queerfeminismus gegründet. Wir sind nach wie vor auf der Suche nach einer politischen Praxis, die dem Rechnung trägt.
Eine Gruppe wie FelS, die den Anspruch hat, auch Menschen jenseits der 30 mit Kind und Kegel zu organisieren, steht beim Versuch, einen Beat zu finden, der älteren Genoss_innen eine regelmäßige und gleichberechtigte Mitarbeit ermöglicht, ohne die jüngeren Companer@s zu brüskieren, die der Gruppe gerne einen Großteil ihrer Zeit widmen wollen, immer wieder vor einer Zerreißprobe. Die regelmäßige Kinderbetreuung während der Gruppentreffen erweist sich in diesem Zusammenhang seit Jahren als sehr hilfreich. Gelöst ist das Problem damit aber noch lange nicht. Hier praktische Lösungen zu finden ist ganz sicher eine der dringlichsten Aufgaben für die nächste Zeit.
Beim nächsten Programmpunkt der „38 Thesen“ dürfte es sich um die bis heute wichtigste Selbstzuschreibung vieler postautonomer Gruppen handeln. Dem arranca!-Postulat aus dem Jahre 1993, die „gesellschaftliche Isolation“ der Linken zu durchbrechen, entspricht der Gruppen übergreifende Anspruch aus dem Jahr 2005, künftig gemeinsam eine Interventionistische Linke zu sein. Mit diesem Ziel wird seit dem Dialog und in Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen außerhalb der radikalen Linken gesucht. Von den Feldern vor Heiligendamm im Juni 2007 bis in die verschneiten Straßen Dresdens im Februar 2011 ist dieses Konzept bisher immer mal wieder aufgegangen.
Auch unabhängig von der Politik der IL hat dieser Anspruch eine enorme Bedeutung für unsere Gruppe. Die FelS-Antifa AG versucht seit Jahren eine selbstreferenziellen und allein auf die linke Szene fokussierte Politik zu vermeiden. Dies ist beispielsweise im Bündnis „NS-Verherrlichung Stoppen“ gelungen, das sich schon länger um „Neue Dresdner Verhältnisse“ bemüht hat. Auch die von FelS initiierten vier Berliner Mayday-Paraden hatten das Ziel, die teilweise selbst verschuldete Isolation der alljährlichen Berliner Szenerituale am 1. Mai zu durchbrechen, was sich jedoch als Daueraufgabe erwiesen hat.
„Für die AG-Arbeit ist auch wichtig, zu gucken, in welchen Lebensverhältnissen wir eigentlich selbst stecken, was für Zeitressourcen und Bedürfnisse sich aus unseren Lebenssituationen ergeben und was das konkret für die AG-Arbeit heißt – das heißt: was können wir als AG eigentlich wuppen, wenn die meisten von uns in Vollzeit-Arbeitsverhältnissen stecken?“
Abbiegerspuren und Richtungswechsel
Was hingegen „das strategische Ziel, Selbstorganisationsformen aufzubauen“ betrifft, so fällt unser Resümee wesentlich nüchterner aus. Die blumige Wortwahl dieser Forderung dürfte sicherlich unserem ehemals sehr intensiven Bezug zu den Hoffnungsträger_innen der Neuen Linken, beispielsweise in Lateinamerika geschuldet sein. Dennoch bringt dieser Anspruch das auf den Punkt, was wir schon seit der Eröffnung unseres fast vergessenen Friedrichshainer Stadtteilladens in den 1990er Jahren in verschiedenen Politikfeldern unter dem Oberbegriff „Alltagspraxis“ zu erreichen versuchen. So ist beispielsweise der Umschwung der FelS Intersol-AG, die früher an der Chiapas-Solidarität und später den Mobilisierungen nach Genua oder Prag beteiligt war, hin zur antirassistischen Vor-Ort-Arbeit z.B. gegen die menschenunwürdige Unterbringung von Flüchtlingen in der Unterkunft in der Berliner Motardstraße oder gegen die rassistische Residenzpflicht, genau dieser „act-local“-Erwägung geschuldet: Selbstorganisation im Alltag zu unterstützen statt nur exemplarisch und stellvertretend internationale Solidarität zu demonstrieren. Dasselbe gilt für die Kampagne der Klima AG für einen kostenfreien öffentlichen Nahverkehr nach dem COP15-Gipfel in Kopenhagen der, die als lokale Strategie gegen die globalen Folgen des Klimawandels geplant war. Auch die Militante Untersuchung der AG Soziale Kämpfe am Jobcenter in Berlin Neukölln zielte darauf ab, mit einer aktivierenden Befragung die Erwerbslosen-Selbstorganisierung voranzutreiben und damit zugleich der drohenden Ritualisierung des Berliner Mayday-Events entgegenzuwirken.
Doch auf dem Weg zur Förderung von Selbstorganisation im Alltag gibt es zahlreiche Fallstricke. Es ist eine Sache, der Tradition linker Stellvertreterpolitik abzuschwören und sich das Suchen nach neuen Praxisformen auf die Fahnen zu schreiben. Wir stehen selbst nicht außerhalb der Zwänge der Ämter, der Unis und der kapitalistischen Erwerbsarbeit. Solange nicht ausschließlich der eigene (Erwerbs-)Alltag im Zentrum von linker Politik stehen soll, stehen diese Widrigkeiten einer kontinuierlichen linken Alltagspraxis immer wieder entgegen. Auch die immer stärkere Fragmentierung der Gesellschaft erschwert widerständige Alltagspraktiken. Denn anders als in Zeiten der fordistischen Fabrik gibt es keinen zentralen Ort, an dem die Folgen der kapitalistischen Ausbeutung ebenso unmittelbar sichtbar werden wie der Widerstand dagegen. Prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse sind – wenn auch an einigen Orten konzentriert - über die ganze Stadt, über die ganze Welt verstreut und äußerst vielfältig. Das behindert nicht nur die kollektive Erkenntnis, in vergleichbare Unterdrückungs- und Ausbeutungsverhältnisse eingebunden zu sein und ein gemeinsames Interesse an ihrer Überwindung zu haben. Auch der Widerstand bleibt so weitgehend unsichtbar, wenn die Erfolge im Kampf gegen Prekarisierung nicht mit massivem Aufwand medial verbreitet werden. Und auch davon abgesehen genügt oft natürlich schon eine einzige schlecht besuchte Aktion oder Demo, um ein Selbstorganisationsprojekt um Monate zurück zu werfen.
Es also kein Wunder, dass bei der gruppeninternen Befragung nach der schönsten FelS-Erinnerung vor allem die großen Kampagnen-Events von G8 bis Dresden und nicht in erster Linie die verschiedenen Alltagspraxen der einzelnen Arbeitsgruppen so oft genannt wurden. Und das trotz „Kampagnenheinz“-Kritik. Angesichts der nachhaltigen politischen Erfolge (Dresden) und der nicht zu leugnenden kontinuitätsstiftenden Effekte (G8) für die Linke passt die Kampagnen-Kritik auf die eben genannten Großereignisse nur bedingt. Die Frage nach der Selbstorganisation im Alltag lassen die Auswertungen all unserer Lieblingsevents aber trotzdem offen, politische Erfolge hin oder her.
Und um uns noch einmal selber zu zitieren und insofern auch noch einmal Bezug zu nehmen auf die ‚Scheitern-Ausgabe‘ der arranca!: „Es ist nicht alles gescheitert, nur weil es nicht zur Weltrevolution geführt hat.“ Also, in diesem Sinne: Zurückblicken – und weitermachen.
FelS | Für eine linke Strömung – Berlin, Juli 2011