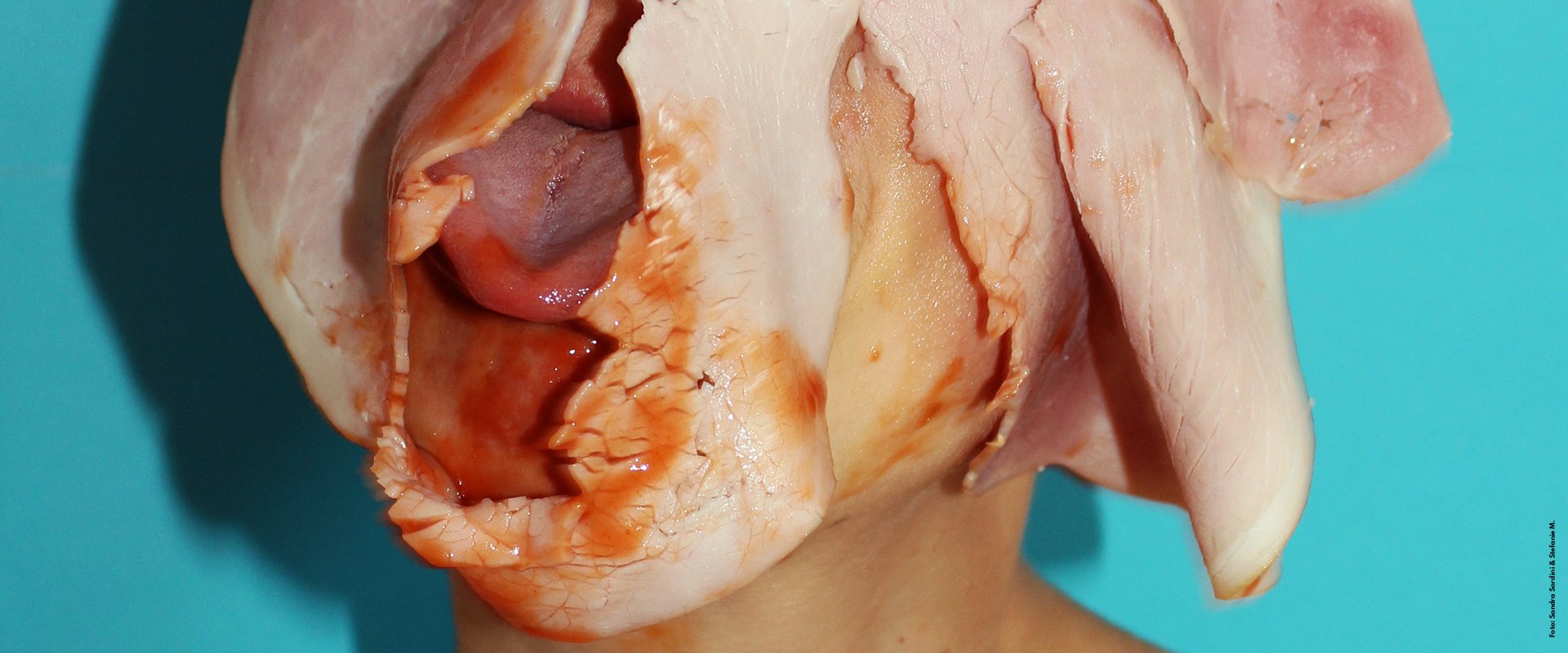Im Interview
Mona Bricke war viele Jahre bei FelS aktiv, hat die Klimagerechtigkeitsbewegung in Deutschland mit aufgebaut und lebt seit 2013 in einer Kommune bei Kassel.
Ines Neumann ist langjährige Klimaaktivistin, sie arbeitet an der Schnittstelle zwischen politischer Bildung und politischer Praxis.
arranca!: ¿Ich bin im Wendland mit der Anti-Atom-Bewegung aufgewachsen und Umwelt war immer ein wichtiges Thema. Wie seid ihr beiden zur Klimagerechtigkeitsbewegung gekommen, war es ein Thema eurer Jugend?
Mona: Meine Jugend hat sich in den 1980er Jahren zugetragen. Damals war neben der Angst vor dem atomaren Wettrüsten auch Waldsterben ein großes Thema. Ich habe politisch mit 14 Jahren bei den Falken in Bonn angefangen und auch dort war Umwelt- und Naturschutz ein Thema. Das hat mich nie ganz verlassen, aber aktivistisch bin ich erst wieder rund um den G8-Gipfel in Heiligendamm zum Thema gestoßen. Der ganz große Kick in Sachen Klimabewegung kam aus Großbritannien. Ich habe damals meinen Master in England gemacht und war dort 2008 an den Vorbereitungen des bis dahin größten Klima-Camps gegen ein Eon-Kohlekraftwerk in der Nähe von London beteiligt. Das war für mich eine wichtige Initialzündung und ich habe da von den Erfahrungen aus der britischen Bewegung ganz viel mitgenommen.
Ines: Umwelt- und Naturschutz, der Globus auf dem wir leben, hat für mich sehr früh schon eine Rolle gespielt. Ich hatte ein Abo einer Kinderzeitung, eine Umweltzeitung. Das war so meins, auch im Gegensatz zu dem, was ich sonst so mit meinen Schwestern geteilt habe. Mitte der 90er Jahre, ich war etwa in der 6. Klasse, habe ich an der Schule eine Arbeitsgemeinschaft mitgegründet. Wir setzten uns mit Umweltschutz, dem Sterben der Ostsee und einer in Rostock geplanten Müllverbrennungsanlage auseinander. Später war ich bei [’solid] - die sozialistische Jugend organisiert. Wir hatten Positionen zu Umwelt und Gesellschaft, aber keine politische Praxis in diesem Feld.
Für mich wurde der G8-Gipfel 2007 in Heiligendamm ein Schlüsselereignis. Damals haben verschiedene Bewegungsteile versucht, den Gipfel zu delegitimieren, um deutlich zu machen, dass die wenigen Herrscher*innen, die sich da treffen, nicht die Lösung von globalen gesellschaftlichen Problemen sind, sondern eher die Ursache. In diesen intensiven Wochen waren wir an vielen Stellen erfolgreich. Aber auf einer politischen Linie haben wir versagt: Klimaschutz wurde plötzlich zu einem zentralen Thema und Angela Merkel wurde damals von Bild & Co als Klimaqueen gefeiert. Die vielen Umweltverbände und Ngos konnten da mitreden, aber wir als radikale Linke hatten keinen Plan.
Einige kluge Köpfe um mich herum haben damals analysiert, dass uns als radikale Linke da ein sehr zentrales Thema, mit dem auch Herrschaftspolitik gemacht und politische Institutionen legitimiert werden, irgendwie entglitten ist. Wir haben das Feld lange anderen überlassen. Doch die Art und Weise wie Umweltverbände dieses Thema angegangen sind – immer eng dran an politischen Entscheidungsträgern in der Hoffnung, man kann dort was verschieben – führte zu nichts. Unterm Strich war es so, dass die vermeintlichen Lösungen der globalen Klimapolitik grundlegend falsche Lösungen waren. Statt Emissionshandel und der Illusion vom grünen Wachstum, kämpfen wir nun für echte Klimagerechtigkeit. Es brauchte eine neue Radikalität, um die Ursachen der Klimakrise wieder in den Fokus zu rücken.
¿Der G8-Gipfel wird als Beginn der Klimagerechtigkeitsbewegung in Deutschland gesehen, für euch war der Gipfelprotest auch ein wichtiger Bezugspunkt. Wie seht ihr das rückblickend?
Ines: Das, was sich unter dem Namen Klimagerechtigkeitsbewegung in Deutschland entwickelt hat, ist in meinen Augen aus den Folgeanalysen der Gipfel-Proteste 2007 entstanden. Wir verfolgten zwei Richtungen: Zum einen mussten wir innerhalb der radikalen Linken dieses Thema setzen. Wir mussten uns dazu bilden, Veranstaltungen machen, Thesen entwickeln, also innerhalb der eigenen Szene eine Diskursintervention betreiben. Zum anderen mussten wir eine Praxis und konkrete Aktivität entwickeln.
Diese Erfahrung vom G8-Protest, wo so wahnsinnig viele tausend Menschen aus verschiedenen Strömungen, Ländern und Richtungen zusammenkamen, sollte nicht verloren gehen. Aus diesem Wunsch in der Pluralität weiter zusammen zu wirken, ist 2008 das erste Klima-Antira-Camp in Hamburg entstanden. Diese thematische Verbindung von Klimakrise und Migration war wichtig um deutlich zu machen, dass die Klimakrise eine sozial-ökologische Frage ist, mit der eine Zuspitzung aller globalen Verhältnisse und gesellschaftlichen Kämpfe einhergeht. Nach dem Motto «Der Ort des Klimawandels ist für uns nicht der schmelzende Gletscher, sondern die kapitalistische Warenproduktion». Es ging also darum, für gesellschaftliche und politische Veränderung hier in Deutschland zu sorgen.
¿Die nächste große Sache nach den Protesten gegen den G8 Gipfel in Heiligendamm war dann die Klimakonferenz in Kopenhagen. Wie ist es zu diesen internationalen Protesten gekommen?
Mona: 2007/08 war ich in England und habe für meine Masterarbeit Klimaaktivist*innen interviewt. Die Aktivist*innen dort hatten bereits 2005 im Zuge des Protests gegen den G7-Gipfel in Schottland für sich beschlossen, das nächste große Thema ist Klima. Deswegen gab es in England schon früh radikale Klima-Camps. Als ich dann 2008 zurück nach Deutschland kam, war klar, das nächste große Thema ist die Un-Klimakonferenz 2009 in Kopenhagen. Die Mobilisierung nach Kopenhagen wurde dann auch beim Klima-Camp in Hamburg beschlossen.
¿Wie bewertet ihr dann rückblickend diesen ersten großen Testlauf, die Proteste gegen die Un-Konferenz in Kopenhagen?
Mona: Ich persönlich muss sagen, dass ich da sehr naiv reingegangen bin. Wir hatten im Vorfeld den Sturm auf das Konferenzzentrum diskutiert und das bedeutet natürlich, dass wir da ins Fadenkreuz der Geheimdienste und Sicherheitskräfte geraten sind. Ich bin im Nachhinein sehr froh, dass es keine Schwerverletzten gegeben hat und niemand ernsthaft zu Schaden gekommen ist. Wir hätten uns viel genauer Gedanken machen sollen, was wir genau erreichen wollen. Die Frage nach den symbolischen Kämpfen spielt hier eine wichtige Rolle. Was für Ziele suchen wir uns aus? Die Kritik an den Gipfelprotesten ist immer gewesen, dass du symbolisch gewinnen kannst, aber was davon hat Bestand? Kopenhagen war die Grundlage für den weiteren Bewegungsaufbau. Im Guardian habe ich gerade ein Interview mit einem Mitbegründer von Extinction Rebellion gelesen, der hat Recht, wenn er sagt, wir müssen uns bei ‹Civil Disobedience› genau fragen, wen wir mitnehmen wollen, wenn wir eine Bewegung aufbauen wollen. Wir wollen ganz junge Leute und alte Leute mitnehmen, welche Methoden wählen wir, damit wir sicher sein können, dass die auch mit im Boot sind? Diese Perspektive haben wir damals nicht so gehabt.
Ines: Ich fand damals die internationalen Vorbereitungen im Climate-Justice-Action-Netzwerk vor der Un-Konferenz 2009 sehr beeindruckend. Viele waren geprägt von der globalisierungskritischen Bewegung, den G8-Gipfel-Protesten und der Idee der Delegitimierung dieser Gipfel. Das funktioniert mit einer Un-Konferenz natürlich nicht so, wie wenn sich da die sieben, acht mächtigsten Regierungschefs zusammensetzen. Bei einer Un-Konferenz sitzen alle Staaten sowie Ngos und Umweltverbände mit am Tisch und sind in den Dialog eingebunden. Es ist eine ganz andere politische Gemengelage. Das war damals schon eine Herausforderung, auf die wir keine wirkliche Antwort hatten. Und dennoch war klar, dass diese Un-Treffen keine grundsätzlichen und dringend notwendigen Veränderungen herbeiführen, um die Klimakrise abzuwenden. Deshalb sollte nicht nur einfach blockiert werden. Wir wollten eine ‹Peoples Assembly› veranstalten, eine Versammlung auf dem Gelände des Gipfels insbesondere der Betroffenen im Globalen Süden, um die Stimmen sichtbar zu machen, die nicht präsent sind. Das war aber naiv mit Blick auf die Machtverhältnisse vor Ort. Wir sind damit gescheitert und haben der jungen Bewegung einen ganz schönen Dämpfer verpasst.
¿Wie ging es nach 2009 weiter mit der Auseinandersetzung in der Klimagerechtigkeitsbewegung, wie ging es weiter bis hin zu Ende Gelände?
Mona: Es gab dann gleich nach Kopenhagen 2010 in Nrw ein Klima-Camp, auf dem sich viele von uns wieder getroffen haben. Dieses erste Camp waren sehr klein, genau wie unser erstes Camp 2011 in Jänschwalde. Das macht Mut für den Bewegungsaufbau, dass wir damals so klein angefangen haben, mit vierzig Leuten. 2014 sind wir dann in Garzweiler zum ersten mal mit einer größeren Gruppe von Leuten in den Tagebau reingegangen und haben gemerkt: Da geht noch mehr! Es ist wichtig, uns die Zeit zum Wachsen zu nehmen und nicht so ungeduldig zu sein in der radikalen Linken, wenn die Entwicklung ein paar Jahre braucht. Bei FelS und in der IL damals war die Arbeit zu Klimagerechtigkeit ein hartes Brot. Dieses Thema zu setzen, hat gedauert.
«Es ist wichtig, uns die Zeit zum Wachsen zu nehmen und nicht so ungeduldig zu sein in der radikalen Linken, wenn die Entwicklung ein paar Jahre braucht.»
Ines: Die Anerkennung des Themenfeldes Klima innerhalb der radikalen Linken und innerhalb der IL ist gestiegen mit der Etablierung der Aktionsform des Zivilen Ungehorsams wie bei Ende Gelände. Wir zogen aus den Protesten gegen den Gipfel in Kopenhagen die Schlussfolgerungen, dass wir a) anstatt zu den Gipfeln zu den Orten der Zerstörung gehen und diese sichtbar machen müssen. Das Ziel war dann nicht mehr die Delegitimierung von Gipfeln, sondern deutlich zu machen, dass der politische Apparat in Deutschland dieses gesellschaftliche Problem nicht löst. Deutschland galt international als Vorreiter für Klimaschutz, dieses Bild wollten wir brechen. Mit dem massiven Braunkohleabbau in Deutschland als dreckigster fossile Energie war es natürlich total naheliegend und sinnvoll, sich darauf zu stürzen. Das Mittel war dann aber nicht eine weitere Demo oder Menschenkette zu machen, sondern b) einen Schritt weiter zu gehen. Um das Thema auf die politische Agenda zu setzen, mussten wir den Konflikt zuspitzen und wollten die Aktion gleichzeitig so anschlussfähig wie möglich machen. Ziviler Ungehorsam und der Anspruch des Niedrigschwelligen ist immer ein Spagat. Deswegen war es wichtig, dass wir viele werden, dass wir massenhafte Aktionen machen. Es war beeindruckend, dass dann schon bei der ersten Ende-Gelände-Aktion 2015 im Rheinland ca. eintausend Menschen dabei waren.
¿Welche Wirkungen konnten die Ende-Gelände-Aktionen denn dann entfalten, was bewirkten sie für die internationale Un-Konferenz, welche Wirkungen hatten sie in Deutschland auf die NGOs und andere Institutionen, die zum Thema Klima arbeiteten?
Mona: Die erste Auflage von Ende Gelände war international geprägt. Ich habe seit 2010 in einer Ngo zum Thema Kohleausstieg gearbeitet und wurde in internationalen Zusammenhängen oft gefragt, warum es in Deutschland zum Thema Kohle keine Bewegung gibt, wo die Menschen sich hinsetzen und blockieren. Es war klar, wenn es das in Deutschland mal gibt, dann ist das in dem Land, in dem so viel Braunkohle wie sonst nirgends auf der Welt abgebaut wird, ein Polarisierungspunkt, wo sich auch Menschen aus anderen Ländern anschließen.
Auch auf viele Ngos zeigte Ende Gelände Wirkung. Besonders auf diejenigen, die schon lange zu Kohle gearbeitet haben. Natürlich gab es auch Berührungsängste, einige hatten Angst vor den neuen Aktionsformen. Die Ausarbeitung eines gemeinsamen Aktionskonsens war total wichtig, darum gab es große Auseinandersetzungen, welche Aktionen in den Rahmen des gemeinsamen Konsens fallen und welche nicht. Das musste alles ausgehandelt werden.
Ines: Das Ende-Gelände-Bündnis hat neuen politischen Druck aufgebaut. Die Besetzung von Baggern, die tagtäglich durch die Förderung von Kohle die Klimakrise mit vorantreiben, hat eine große Dynamik ausgelöst. Die Verursachung und damit die Handlungsmöglichkeiten vor Ort wurden sichtbar. Bereits bestehende Gruppen wie ausgeCO2hlt, lokale Bürgerinitiativen u.v.a. waren sehr wichtig für diese Dynamik.
Der Hambacher Forst war damals schon zwei Jahre besetzt. Das wusste aber kaum jemand. Das barg mit Ende Gelände im Hambacher Tagebau auch Konfliktpotential: Da waren seit Jahren Einzelpersonen und Gruppen aktiv und auf einmal kommt da mal für so ein Wochenende eine große Aktion vorbeigeflattert und macht einen riesigen Trubel. Darum gab es große Auseinandersetzungen. Was mich am meisten beeindruckte, das ist das Bemühen von Schlüsselfiguren auf beiden Seiten, eine solidarische Praxis miteinander zu finden. Wir beziehen uns aufeinander in dem Wissen, dass es uns grundsätzlich um die gleichen Ziele geht, aber die politischen Praxen und Kulturen andere sind. Das ist ein enormer Erfolg, der auch möglich gemacht hat, dass diese Waldbesetzung immer bekannter wurde. Am Anfang waren es ein paar Dutzend und am Ende waren es Tausende. Und dass der Hambacher Forst zum Symbol der politischen Auseinandersetzung werden konnte, dazu haben sehr viele beigetragen: die Besetzer*innen, lokale Bürgerinitiativen, Umweltverbände, Ende Gelände, Anwohner*innen, die Waldspaziergänge und viele mehr.
¿Was macht diese Klimakrise eigentlich mit uns persönlich? Wie gehen wir damit um, dass unsere Lebensgrundlage immer mehr zerstört wird?
Mona: Ich hatte 2016 einen Burn-Out. Ein Grund dafür war sicherlich, dass die Arbeit am Klimathema immer auch ein emotionales Thema ist. Wenn ich das an mich heranlasse, dann werde ich manchmal unglaublich traurig und verzweifelt. Ich habe auch Pressearbeit gemacht, Ngo-Arbeit, bin durch die Welt geflogen, die ganze Zeit ging es um Fakten, Widerstand, Protest und gleichzeitig habe ich diese Themen von mir abgespalten, diese Trauer, dass mir manchmal die Tränen kommen, wenn ich darüber nachdenke, was es alles wirklich bedeutet. Das ist manchmal kaum zu ertragen, aber ich bin da durchgegangen und bin auch überzeugt, dass wir uns die Zeit nehmen müssen, zu trauern, um unsere Art zu leben, die sich verändern muss, damit wir alle, auf der ganzen Welt, ein gutes Leben führen können. Und in der Möglichkeit auf Veränderung steckt dann auch wieder viel Hoffnung. Aber ich glaube, dass die Traurigkeit das Thema schwierig macht und natürlich auch für die radikale Linke.
«Das ist manchmal kaum zu ertragen, aber ich bin da durchgegangen und bin auch überzeugt, dass wir uns die Zeit nehmen müssen, zu trauern, um unsere Art zu leben, die sich verändern muss, damit wir alle, auf der ganzen Welt, ein gutes Leben führen können.»
Ich lebe in einer Kommune, wir haben gerade einen Biomeiler gebaut, zur Wassererwärmung, der gleichzeitig eine CO2-Senke ist. Ich will selber auch an Lösungen arbeiten, das hat mich verändert. Wir bauen hier jetzt auch ein Bildungszentrum auf. Ich möchte mich in Zukunft mit der Frage nach nachhaltigem Aktivismus beschäftigen. Wie können wir uns mit Klimawandel und Artensterben beschäftigen ohne die Gefühle, die da entstehen, abzuspalten? Ich sehe das immer noch als Aktivismus, aber auf einer anderen Ebene.
¿Inwiefern ist die eigene Emotionalität bei dem Thema Klima eine Frage in der Klimagerechtigkeitsbewegung?
Ines: Ganz besonders greift die Fridays-for-Future-Bewegung als neuer Akteur dieser Bewegung diese Frage auf. Wenn wir unsere Positionen zu Klimagerechtigkeit, ernst nehmen, was heißt das für unsere Lebensweise? Es ist klar, dass die Grundlage, auf der wir leben, nicht global verallgemeinerbarer ist. Eine klassische linke Antwort ist immer, wir müssen die gesellschaftlichen Strukturen verändern, damit ein anderes Verhalten möglich ist. Wir dürfen also nicht einfach moralisch an das Verhalten der Individuen appellieren, weil wir alle eingebunden sind in diese Verhältnisse. Das betrifft die Frage danach, wo kaufe ich meine Sachen ein, sind die Lebensmittel Bio aus der Region oder brauche ich mein Auto, um überhaupt arbeiten fahren zu können? Wir können die Individuen aber nicht aus der Verantwortung nehmen. Bei Fridays for Future setzen die jungen Menschen ihre Eltern unter Druck und fragen, sagt mal, wie konntest du Jahrzehnte die Augen verschließen und nichts machen? Sie stellen die Frage nach der persönlichen Verantwortung in Bezug auf eine globale Krise von der niemand behaupten kann, er*sie wüsste von nichts. Die Antworten auf diese Fragen zeigen das Dilemma einer komplexen, globalisierten Welt, die oft eine Überforderung für die Menschen darstellt. Wie soll denn der Einzelne vor Ort verantwortlich dafür sein, dass man global ganz andere Regelungen bräuchte? Unsere Antwort als politische Bewegung darauf ist, Aktionsformen und Aktionsangebote zu machen, um den Druck gemeinsam an richtiger Stelle zu produzieren um diese strukturellen Veränderungen herbeizuführen.
¿Was wollt ihr der Klimabewegung noch mit auf den Weg geben?
Ines: Klimapolitik passiert überall. Im Bereich Verkehr, Mobilität und Landwirtschaft entstehen gerade neue Akteure, das ist super. Doch alle werben um Aufmerksamkeit und Unterstützung in einer noch sehr kleinen Bewegung. Wir müssen gut überlegen, an welcher Stelle macht es wo Sinn, Kräfte zu bündeln und politisch wirkmächtig zu werden. Wenn wir eines aus erfolgreichen sozialen Bewegungen gelernt haben, dann, dass wir einen sehr langen Atem brauchen. Wenn nun in der Bundesregierung konkret über Ausstiegsszenarien gesprochen wird, dann zeigt das, wir haben was gewonnen. Und dennoch ist das Ergebnis der ‹Kohlekommission› total absurd. In zwanzig Jahren soll der Kohleausstieg erst passieren? Das ist zum einen gesellschaftlich fatal und zum anderen für Bewegungen ein unglaublich großer Zeitraum. Wir werden schon nervös, wenn wir drei Jahre hintereinander das Gleiche gemacht haben. Da sage ich nein: Wir müssen vielleicht andere Formen finden, aber wir dürfen das Thema nicht alleine lassen. Das sollten wir alle von der Anti-Akw-Bewegung gelernt haben. Da ist die radikale Linke nicht so gut drin, aber das kann noch werden.
Mona: Lasst euch nicht so schnell befrieden! Ich bin optimistisch, besonders wegen Fridays for Future, weil das Thema jetzt nochmal mehr bei uns selber ankommt. Die Generation, die da jetzt die Proteste macht, hat Recht, wenn sie sagt: Wir bekommen die Rechnung für das serviert, was ihr uns eingebrockt habt. Durch die Kämpfe jetzt können wir alle nur gewinnen.