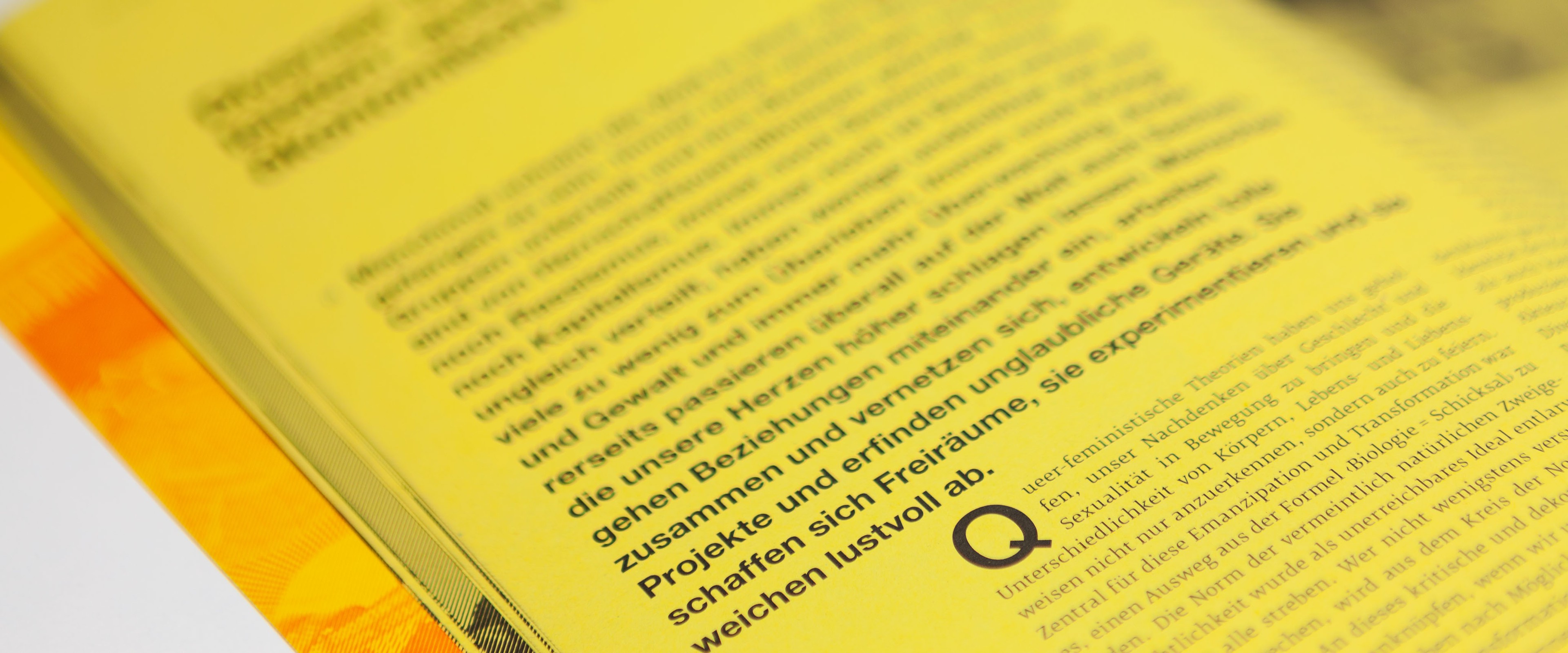Manchmal scheint die Welt in einer winterlichen Starre gefangen zu sein. Immer noch werden Menschen in Gruppen unterteilt und ihre Beziehungen zueinandersind von Herrschaftsverhältnissen geprägt. Immer noch Rassismus, immer noch Sexismus, immer noch Kapitalismus. Immer noch ist Besitz extrem ungleich verteilt, haben wenige undenkbar viel und viele zu wenig zum Überleben. Immer noch Kriegeund Gewalt und immer mehr Überwachung. Andererseits passieren überall auf der Welt auch Sachen, die unsere Herzen höher schlagen lassen. Menschen gehen Beziehungen miteinander ein, arbeiten zusammen und vernetzen sich, entwickeln tolle Projekte und erfinden unglaubliche Geräte. Sie schaffen sich Freiräume, sie experimentieren und sie weichen lustvoll ab.
Queer-feministische Theorien haben uns geholfen, unser Nachdenken über Geschlecht und Sexualität in Bewegung zu bringen und die Unterschiedlichkeit von Körpern, Lebens- und Liebensweisen nicht nur anzuerkennen, sondern auch zu feiern. Zentral für diese Emanzipation und Transformation war es, einen Ausweg aus der Formel ‹Biologie = Schicksal› zu finden. Die Norm der vermeintlich natürlichen Zweigeschlechtlichkeit wurde als unerreichbares Ideal entlarvt, nach dem alle streben. Wer nicht wenigstens versucht, ihr zu entsprechen, wird aus dem Kreis der Normalen ausgeschlossen. An dieses kritische und dekonstruktive Denken wollen wir anknüpfen, wenn wir uns in diesem Text auf die Suche begeben nach Möglichkeiten, die Spuren gesellschaftlicher Transformation, die in unseren Alltagspraxen stecken, zu erkennen, zu reflektieren und zu intensivieren. Alles beginnt für uns also damit, die Norm des Kapitalismus, seine vermeintliche Omnipotenz und seinen Anspruch auf Universalität anzugreifen.
Die regulatorische Fiktion ‹Kapitalismus› dekonstruieren
J.K. Gibson-Graham, die sich mit nichtkapitalistischen ökonomischen Praxen beschäftigen, liefern uns einen ersten Ansatz, Ökonomie anders zu denken. Sie kritisieren unseres Erachtens nach zu Recht, dass ‹Kapitalismus› als akkurate Beschreibung der wirtschaftlichen Realität gilt. Ähnlich wie Judith Butler es für Geschlechtsidentität vorgeschlagen hat, begreifen sie das Konzept ‹Kapitalismus› als eine regulatorische Fiktion. Der Kapitalismus wird dabei so dargestellt, als sei er total normal, nahezu natürlich und zugleich übermächtig und unaufhaltsam. Kapitalismus ist der Master Term, von dem aus definiert wird, was Zentrum und Peripherie, was Produktion und Reproduktion ist. Es scheint, als sei er die bestimmende und treibende Kraft hinter allen denkbaren gesellschaftlichen Entwicklungen. An dieser Identität des Kapitalismus stricken sowohl hegemoniale als auch kapitalismuskritische Aussagen mit: Beide reproduzieren das Bild des Kapitalismus als omnipotenter Akteur im Spiel der Kräfte. Damit wird der Blick auf die Diversität sozialer, kultureller, aber auch ökonomischer Praxen, das heißt auf bestehende und denkbare Formen des Wirtschaftens jenseits kapitalistischer Ausbeutung und Verwertung, beharrlich verdeckt. Versuchen wir also einmal, dem ‹kapitalozentrischen› Diskurs einen Diskurs der ökonomischen Vielfalt entgegenzusetzen und überlegen wir, in welchen Formen wir knappe Güter und Dienstleistungen produzieren, verteilen und konsumieren. Wenn wir ‹wirtschaften›, sind wir nicht immer Teil von Prozessen, bei denen Arbeitskraft gegen Lohn verkauft wird und in denen Profit vom Kapitalbesitzer in Form von Mehrwert angeeignet wird. Manchmal verschenken wir unsere Arbeitskraft oder tauschen sie gegen Geld, das nicht direkt aus dem kapitalistischen Wirtschaften kommt. Manche betreiben neben der Lohnarbeit unabhängige Produktion in ihren Gärten. Manchmal tauschen wir Güter oder Dienstleistungen mit unseren Liebsten auch direkt.
Unserer Erfahrung nach werden die ökonomischen Aspekte eines vermeintlich ‹nicht-ökonomischen› Teils unseres Lebens zu häufig ausgeblendet. Ökonomie kommt uns immer so unangenehm kapitalistisch vor, aber ist sie das in jedem Fall? Oder ist sie genauso divers wie Geschlecht und Sexualität es sein können? Wenn Gegen-Narrative zum kapitalozentrischen Denken jenseits kapitalistischer Ausbeutungsverhältnisse geschaffen werden sollen, dann muss auch Klasse als prozesshaft, komplex und nicht kohärent konzipiert werden. Damit greifen wir die dekonstruktivistische Kritik an der Vorstellung von kohärenten Identitäten auf, die mit der Unsichtbarmachung Anderer einhergehen. Etablierte und ausgrenzende Identitätsformen, wie beispielsweise die gewerkschaftlich repräsentierte Arbeiterklasse, aber auch die ‹Klasse der Kapitalisten›, können so destabilisiert werden. Nicht nur Menschen, die in sogenannten atypischen Beschäftigungsverhältnissen als Hausfrauen und -männer, Selbstständige oder Freelancer arbeiten, sind in komplexe und sich wandelnde Klassenprozesse eingebunden, sondern auch der männliche ‹Normalarbeiter›, der in seiner Freizeit fischen geht und in einem ökonomischen Austauschprozess mit seiner reproduktionsarbeitenden Ehefrau steht. Wir glauben, dass diese dekonstruktivistische Perspektive auf sexuelle und ökonomische Identitäten transformatorische Praxen voran bringen kann. Zunächst, indem sie nach dem fragt, was ausgeschlossen und übergangen wird und es dadurch möglich macht, Machtsensibilität in konkrete Projekte einzuschreiben. Aber auch, indem sie Leidenschaft für politische Projekte entstehen lässt, die jenseits von binären Codes vielfältiges, lustvolles Leben, Denken und Arbeiten ermöglichen.
Aus queer-feministischer Perspektive gehen wir auf die Spurensuche nach ökonomischen Prozessen der Transformation, die wir in bestehenden Praxen erkennen können. Es existieren Projekte, bei denen Menschen Ressourcen wie Geld, Zeit und Produktionsmittel kollektiv nutzen, um gemeinsam oder individuell an Sachen zu arbeiten, die ihnen Spaß machen und mit denen sie ein gesellschaftliches Ziel verbinden. Ein Beispiel dafür sind Hackerspaces. In diesen Räumen treffen sich Menschen, die sich für Technologie, Computer, Programmieren, Basteln, Kunst und Wissenschaft interessieren, um zusammen abzuhängen und zu arbeiten. Es gibt dort nicht nur Rechner, sondern auch Labore, Maschinen, Werkzeug, Bastelmaterial und vor allem Wissen, das geteilt werden kann. Ihrem Selbstverständnis nach sind Hackerspaces nicht dazu da, Startups zu gründen, um die gemeinsamen Arbeitsergebnisse als Waren kapitalistisch zu verwerten. Vielmehr geht es darum, Produkte (weiter) zu entwickeln und zugänglich zu machen. Dass es dabei auch zu kritischen Auseinandersetzungen um Machtpositionen kommt, zeigt der Text Hacking The Spaces. Johannes Grenzfurthner und Frank Apunkt Schneider problematisieren darin, dass Hackerspaces überwiegend von weißen, männlichen Nerds gestaltet werden und fordern, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie sich dies auf die Praxis der Hackerspaces auswirkt. Hackerspaces stehen in einer linken, gegenkulturellen Tradition, sich Freiräume zu schaffen. Und sie überschreiten Grenzen: Nicht nur zwischen Wohnzimmer und Arbeitsplatz wird die vermeintliche Trennung aufgehoben, sondern auch die Gegenüberstellung von Arbeit mit Kunstmachen und Spaßhaben wird durchquert. Sie können Räume sein, die Arbeitsweisen und Technologien entwickeln, die zur Veränderung der Gesellschaft beitragen und Systeme im besten Sinne von benutzeruntypischem Verhalten hacken.
Freiheit und Prekarisierungsweisen in neoliberalen Verhältnissen
Aber wohin soll die Reise gehen? Was sind unsere Koordinaten, nach denen wir transformatorische Projekte politisch gestalten und bewerten wollen? Es geht nicht darum, die Frage nach den Auswirkungen kapitalistischer Verhältnisse auf die Gesellschaft und auf die unterschiedlichsten Aspekte des Lebens nicht mehr zu stellen. Als Ausgangspunkt finden wir – die wir nicht länger auf die Weltrevolution warten wollen – es konstruktiv, dafür die momentanen neoliberalen Vergesellschaftungsprozesse in all ihren diskursiven Widersprüchlichkeiten und sozialen Effekten in den Blick zu nehmen. Unter Neoliberalismus verstehen wir die Ökonomisierung von immer mehr Gesellschaftsbereichen entlang eines marktlogischen Verwertungsinteresses. Dieser Prozess ist mit einem Menschenbild verbunden, welches Subjekte als ‹Unternehmer_innen ihrer selbst› anruft. Demnach haben angeblich alle die gleichen Chancen, Kosten und Nutzen richtig abzuwägen. Alle haben die ‹Wahl›. Jede kann es schaffen, wenn sie nur gebildet und fleißig genug ist. Antke Engel stellt die These auf, dass die breite politische Zustimmung zu neoliberaler Rationalität durch die positive Neubewertung von Differenz abgesichert wird. Einerseits führen veränderte Lohn- und Arbeitsbedingungen sowie der Abbau staatlicher Leistungen zu einer Verschärfung des ökonomischen Drucks und zu sozialer Unsicherheit. Auf der anderen Seite versprechen neoliberale Regierungsweisen jedoch einen Freiheitsgewinn: Eigenverantwortung und Leistungsindividualismus werden eben nicht nur negativ erlebt, sondern ermöglichen persönliche Entfaltung jenseits normierter Formen der Lebensgestaltung. Dazu kommt, dass ökonomische Verwertungsinteressen nicht-normativen und hybriden Identitäten nicht mehr per se entgegen stehen, sondern diese geradezu befördern: Ein offenes gesellschaftliches Klima, Diversität und das Vorhandensein von schwulen Szenevierteln gelten beispielsweise als entscheidende Standortfaktoren, wenn es darum geht, die ‹kreative Klasse› in eine Stadt zu locken. Doch kommt es dort, wo einerseits eine Anerkennung von Differenz/en zu verzeichnen ist, andererseits zu einer Prekarisierung von Arbeits- und Lebensverhältnissen und zur Privatisierung von immer mehr ‹Lebensrisiken›. Ob Karies oder das Rentenalter: Wer nicht individuell vorsorgt, hat Pech gehabt. Deshalb spricht Engel in diesem Zusammenhang treffend von privatisierter Freiheit jenseits sozialer Gerechtigkeit. Individuelle Leistungsfähigkeit ist dabei das Maß, anhand dessen bestimmt wird, welche Differenzen anerkannt werden und welche nicht. Der Umgang mit den komplexen Anforderungen und strukturellen Problemen wird auf die einzelnen Individuen abgewälzt. Das Subjekt, das alle neoliberalen und recht widersprüchlichen Anforderungen irgendwie managen muss, kann also als Kristallisationspunkt neoliberaler Regierungsweisen gesehen werden.
Über die Klassenfrage hinaus
Vor diesem Hintergrund sollte nach unserem Verständnis eine queer-feministische Ökonomiekritik den Antagonismus zwischen Arbeit und Kapital nicht zum Ausgangspunkt nehmen. Denn die Bedeutung anderer gesellschaftlicher Strukturkategorien droht neben derjenigen der ‹Klasse› unter den Tisch zu fallen. Spätestens mit der Intersektionalitätsdebatte sind die Zeiten des Hauptwiderspruchs endgültig vorbei: Die Erkenntnis, dass gesellschaftliche Machtverhältnisse und Identitätskategorien nur in ihrer Verschränkung betrachtet und politisiert werden können, gilt es für queeres ökonomiekritisches Denken produktiv zu machen. Dies bedeutet zum einen, dass Geschlecht nicht ohne Sexualität gedacht werden kann, Männlichkeit und Weiblichkeit nicht ohne Rassialisierungspraxen und Sexualität wiederum nicht ohne Körperdiskurse, die Menschen in ‹gesund› und ‹krank/behindert›, ‹jung› und ‹alt› einteilen. Zum anderen heißt es aber auch, dass nicht nur Diskriminierungs- und Ausgrenzungspraxen, sondern auch Privilegien vor dem Hintergrund eines komplexen Verständnisses von gesellschaftlichen Machtverhältnissen untersucht werden müssen. Die ‹Klassenfrage› muss also durch eine Analyse der vielfältigen Positionierungen in Erwerbs- und Reproduktionsarbeitsverhältnissen ersetzt werden. Wie das funktionieren kann, zeigen die Mobilisierungen zum Euromayday. Die Aktivist_innen scheuen sich nicht, den Individualisierungsdruck anzugreifen und gleichzeitig auf individuellen Rechten zu bestehen, die Vermarktung von Differenzen kritisch zu thematisieren und sich gleichzeitig aus prekären Sprechpositionen auf provisorische Identitäten zu berufen. Das Beispiel zeigt, dass die Widersprüchlichkeiten neoliberaler Regierungsweisen für politische Praxen genutzt werden können.
Alle arbeiten sexuell
Wir wollen Denk- und Praxisstrategien weiterverfolgen, die diesen Schritt gemacht haben. Dazu brauchen wir einen erweiterten Arbeitsbegriff. Das Konzept der ‹Sexuellen Arbeit› von Pauline Boudry, Brigitta Kuster und Renate Lorenz macht deutlich, dass Arbeit immer auch eine emotionale Komponente hat, die mit normativer Heterosexualität bzw. Sexualität im Allgemeinen verknüpft ist. Ein klassisches Beispiel ist die Sorge-Arbeit, welche vermeintlich aus Liebe gern freiwillig und unbezahlt getan wird, oder die Stewardess, die mit ihren männlichen Fluggästen flirtet. Aber auch ein Hausmeister verkörpert heterosexuelle Männlichkeit, und in politischen Projekten arbeiten wir ebenfalls sexuell. Denn immer sind Fähigkeiten und Emotionen gefordert, die dem Bereich der Persönlichkeit zugeordnet werden. Persönliche Verhältnisse zu Kolleg_innen, Chef_ innen und Genoss_innen müssen aufgebaut werden und je nach Job und Position sind bestimmte zugehörige Charaktereigenschaften zu performen: Freundlichkeit, Durchsetzungsstärke, Einfühlungsvermögen usw. Für die Subjekte heißt das, sich selbst zu regieren und den gesellschaftlichen Regeln zu unterwerfen, um handlungsfähig zu werden. Die Aufforderung, entlang der Verkörperung persönlicher Eigenschaften bestimmte Rollen einzunehmen, ist zugleich Drohung und Versprechen, in einem hohen Maße geschlechtsspezifisch und durch die heteronormative Struktur der Gesellschaft geprägt. Ein freches Dienstmädchen würde ‹bestraft›, ein Professor, der beim Thema ‹Armut› in Tränen ausbricht, ebenfalls. Wenn es ihnen gelingt, ihre Rollen richtig zu verkörpern, läuft auch der Arbeitstag einigermaßen rund und sexuelle Arbeit war mal wieder doppelt produktiv: Sie hat Dienstleistungen und Produkte, aber auch verkörperlichte, vergeschlechtlichte und sexuelle Subjekte hergestellt. Sexualität und Arbeit sind eben nicht zwei getrennte Sphären von sexueller Selbstbestimmtheit in der Freizeit und Entfremdung und Zwang auf der Arbeit. Das Konzept der ‹Sexuellen Arbeit› lenkt den Blick auf die Gemeinsamkeiten dieser vermeintlich individuellen Erfahrungen und kann sie damit politisieren. Es ist möglich und nötig, diese Anrufungen zu durchqueren und umzuarbeiten, ihnen teilweise nicht zu entsprechen oder daran produktiv zu scheitern. Das neoliberale Versprechen individueller Freiheit stößt gerade hier an seine Grenzen. Durch das Fehlen notwendiger materieller Ressourcen wie sozialer Transferleistungen oder kostenloser Bildung wird der Zwang, sich als Subjekt in Arbeitsverhältnissen mittels sexueller Arbeit auf bestimmte Weisen zu konstituieren, immer wieder erneuert. Aus queer-feministischer Sicht scheint es uns deshalb zentral, genau die Diskurse anzugreifen, die eine Stabilisierung normativer Verhältnisse und vorgeschriebener Identitätskonstruktionen stützen.
Queering and Hacking Capitalism!
Und damit zurück zur politischen Praxis: Divers leben, wirtschaften und mit politischen Strategien umgehen! Das geht gut zusammen, denn wenn ‹alle› so unterschiedlich sind, brauchen wir diverse politische Praxen, die auf unterschiedlichen Ebenen ansetzen und mit verschiedenen Strategien arbeiten. Anfangen können wir damit, uns zu fragen, für welche Zwecke wir uns selbst ausbeuten. Es kann damit weitergehen, Lohn und andere Ressourcen aus der Erwerbsarbeit zu nutzen, um ökonomische und ökologische Alternativen zu entwickeln. Wir denken hier dank Friederike Habermann zum Beispiel an Hausprojekte, die anders mit Eigentum umgehen, Umsonstläden, Foodcoops und Guerillagärtner_innen oder Freifunkprojekte, die kostenloses Wlan in die Städte bringen. Neben solchen Alltagspraxen wollen wir aber auch Forderungen an das System stellen. Um eine grundsätzliche Umverteilung von oben nach unten zu erkämpfen, sollten wir den Mythos der Vollbeschäftigung endlich ziehen lassen. Im Angesicht steigender Armut in den verschiedensten Prekarisierungsweisen und vor dem Hintergrund des aktivierenden Sozialstaates, der den steigenden ökonomischen Druck auf die Schultern der Individuen legt, ist die Forderung eines bedingungslosen Grundeinkommens eine sinnvolle Intervention in die Anrufung der Subjekte als ‹Unternehmer_innen ihrer selbst›. Abhängigkeitsverhältnisse zwischen erwachsenen Personen könnten damit zurückgefahren werden, heteronormative Strukturen könnten ihre soziale und steuerliche Bevorzugung verlieren und der feminisierte und ethnisierte Niedriglohnsektor würde quasi ausgehebelt, denn Menschen müssten ihre Arbeitskraft eben nicht mehr um jeden Preis verkaufen. Auch wenn das bedingungslose Grundeinkommen wie ein paternalistisches Instrument der Gleichbehandlung daher kommt, eröffnet es neue Möglichkeiten der selbstbestimmten Repräsentation von Subjektivität, Sexualität, Arbeitszusammenhängen und Lebensformen. So wie queere Praxen die gesellschaftlich vorgegebenen binären Geschlechtercodes unterlaufen, versuchen wir, das regulatorische Ideal des Kapitalismus samt seiner Vorstellung von Arbeit zu hacken, denn vor lauter kapitalistischer Hegemonie besteht sonst die Gefahr, dass vielfältige Alltagspraxen, die Herrschaftsverhältnisse bereits durchqueren, nicht wahrgenommen werden. Wir sollten versuchen, immer weiter genau dagegen anzudenken, um das Begehren nach Transformation zu beleben, ohne uns vom übermächtigen Monster ‹Kapitalismus› grundsätzlich entmutigen zu lassen.