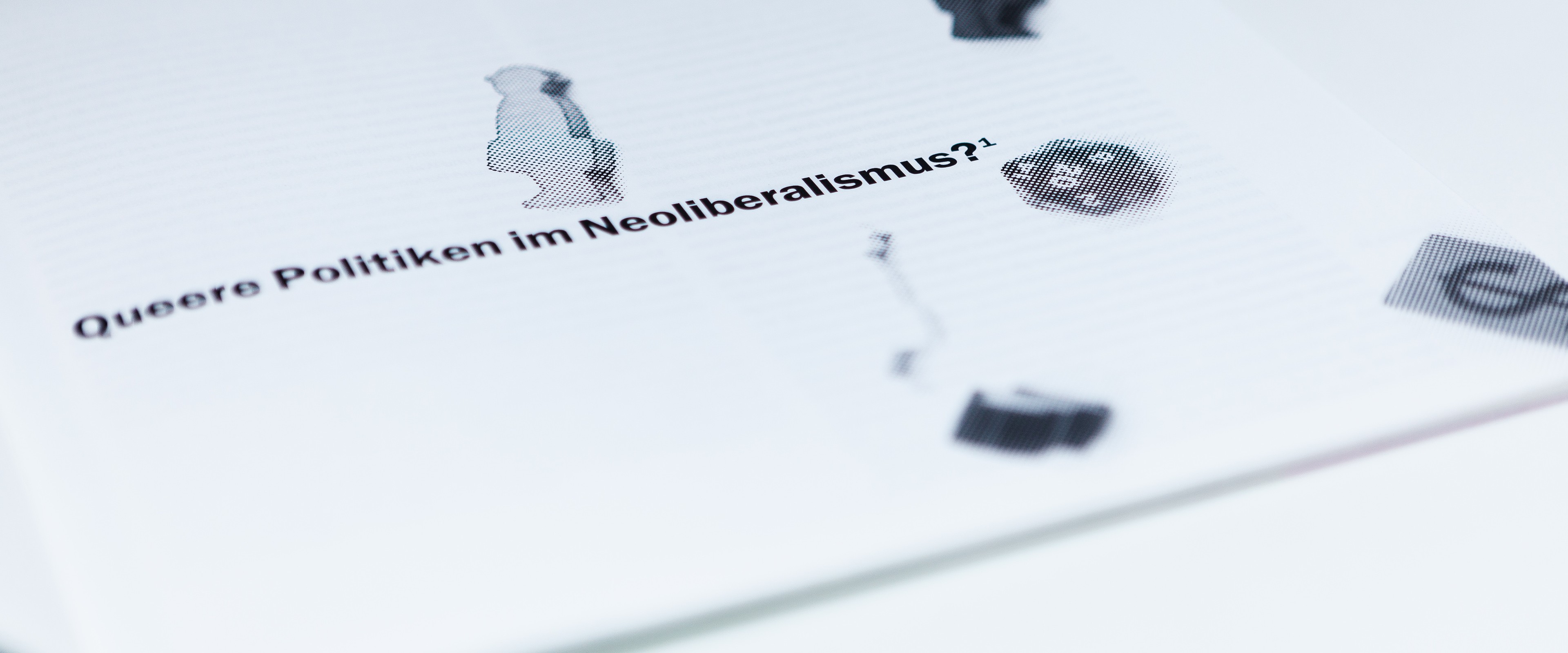Umgekehrt resultiert aus einer Ökonomie-zentrierten Kritik gesellschaftlicher Verhältnisse nur zu leicht eine „Ableitung“ sozialer Kämpfe in der Sphäre von Kultur, die ihren „wahren“ Widerspruch doch eigentlich im Verhältnis von Kapital und Arbeit hätten. Von manchen wird queerer Aktivismus als lediglich individuell-private Identitätspolitik als Antwort auf die Zweigeschlechternorm gelesen, die die strukturellen Widersprüche kapitalistischer Vergesellschaftung verkennt und ein subversives Außen suggeriert, das es nicht geben kann.1
Ich möchte gegenüber diesen verkürzenden und meiner Ansicht nach irreführenden analytischen und begrifflichen Deutungen eine andere Sicht entgegenstellen: Queere Politiken, Praktiken und Kritik blenden nicht zwangsläufig aus, dass sexuelle Identitäten, Begehren und Gender-Konstruktionen ihren materiellen Kern in der jeweils historisch aktuellen Konstellation von vergeschlechtlichter Arbeitsteilung und kapitalistischer Reproduktion und Regulation haben. Eine Lesart von „queer“ ist die, dass es sich um eine Antwort auf die Dilemmata identitätspolitischer Politiken der schwul-lesbischen Communities und ihres Kampfes gegen Diskriminierung und für Anerkennung jenseits heterosexueller gesellschaftlicher Normen vor allem in den 1970er und 1980er Jahren in den USA und später auch hierzulande handelt. Damit ist aber nicht allein die Entwicklung bestimmter gegenkultureller sozialer Handlungsweisen und Selbstidentifikationen gemeint, sondern auch, dass „queer“ mit Verschiebungen heterosexueller gesellschaftlicher Anordnungen zu tun hat. Wird nun durch das Entstehen von queeren Bewegungen eine Krise heterosexueller gesellschaftlicher Strukturen deutlich? Kann man queere soziale Handlungsformen als zunehmende Flexibilisierung des kapitalistischen GenderRegimes lesen, das gleichwohl seine dominante Heteronormativität wahren kann? Ich verstehe einen kritischen Umgang mit queeren Perspektiven im Gegenteil, bezogen auf die Dynamik sozialer Bewegungen, als eine neuere, radikalere Form von Kritik, die aus den jüngsten Entwicklungen der Einbindung und Integration der Perspektiven sozialer Bewegungen in das gegenwärtige kapitalistische Herrschaftsprojekt zu lernen versucht und deren Vereinnahmung in herrschaftsförmige MittäterInnenschaft reflektieren und damit umgehen will. Ich möchte an dieser Stelle vorsichtig anmerken, dass nicht schon das Markieren der Ausschlusslogik von Anerkennungskämpfen ein widerständiger Akt sein muss – „queer“ also nicht automatisch „subversiver“ als schwul-lesbische Identitätspolitik kodiert sein muss.
Kapitalismus ohne Heterosexualität?
Rosemary Hennessy hat die provokante Behauptung aufgestellt, dass der Kapitalismus in seiner gegenwärtigen Form auch ohne Heterosexualität oder eine sexuelle Gesellschaftsordnung auskommen könnte2, nicht aber ohne asymmetrische gesellschaftliche Arbeitsteilung und damit verbundene soziale Hierarchien. Im Klartext: Sie widerspricht der Hoffnung, mit einer Veränderung heterosexueller Normen sei an sich schon eine Dezentrierung kapitalistischer Vergesellschaftungsgrundlagen (wie der heterosexuellen Kleinfamilie) verbunden – ein umstreitbarer Punkt. Im Gegenteil analysiert sie für die Gegenwart, dass der neoliberal gewendete Kapitalismus so flexibel ist, auch Praktiken seiner KritikerInnen und den Angriff auf Zweigeschlechtlichkeit produktiv zu wenden. Sie nennt als Beispiel die Konsumbezogenheit vorwiegend von Schwulen aus der amerikanischen Mittelschicht, die als solvente Kunden ins Licht von Werbung, Marketing und warenbezogener Repräsentation rücken, neue Märkte mit erschließen und vergleichsweise individuell und kaufkräftig sind. Für sie ist Konsum gleichsam Bedingung ihrer Selbstdarstellung – und -verhältnisse. Dabei wird aber auch klar, wer und welche in diesen Bildern nicht mitgemeint ist und dass es gilt, Klassenverhältnisse quer zu hetero-homosexuellen Identitätengegensätzen zu thematisieren, um deren jeweilige Artikulationsformen verstehen zu können.
Könnte man dieses Beispiel als Kooptationsversuch einer dominant heterosexuell organisierten Konsum- und Warenwelt und darauf bezogener Praktiken interpretieren, als Versuch der Inklusion dessen, was in die Logik dieser Warenwelt integrierbar ist, so beleuchtet Hennessy mit einem weiteren Beispiel das Verstricktsein queeren kritischen, versuchsweise subversiven Aktivismus in die Anerkennungs- und Aufmerksamkeitsökonomie gegenwärtiger kapitalistischer Konsumformen und sozialer Bezüge. Hennessy beschreibt Aktionen queer-aktivistischer Gruppen in den USA in den 1990er Jahren, die shopping malls als Feld ihrer Sichtbarmachungspolitik und Substitut von Partizipationsmöglichkeiten in demokratischen Öffentlichkeiten wählten. Versucht wurde, sich mit Körper-Inszenierungen wie offen gezeigtem sexuellen Begehren in dieser Öffentlichkeit mit Gegen-Bildern und -praktiken zu behaupten und ein Problembewusstsein dafür zu schaffen, dass nicht-heterosexuelle Lebensweisen von dieser Konsum-Öffentlichkeit ausgeschlossen sind.
Hier, sagt Hennessy, kommt es auf den wichtigen Unterschied an zwischen dem Sicht- und dem Sehbaren. Sexuelle und geschlechterbezogene Politiken und Wahrnehmungen auf das Sichtbare einzuschränken, auf Text, Style und Performativität, verdient nach ihr die Kritik des „nur“ auf Repräsentationen, Oberflächenphänomene und sichtbare Positionen verkürzten Blicks. Die Betonung des Sehbaren, hier bezieht sie sich auf Marx, ist dagegen analytisch auf das gegenwärtig nicht Sichtbare gerichtet und versucht, systematisch und in gesellschaftlich dominanten Kräfteverhältnissen Ausgeschlossenes (Klassenverhältnisse, ethnische und GenderStrukturen) einzubeziehen. In diesem Sinne geht es mit Hennessy nicht um pure Ideologiekritik heterosexueller Vergesellschaftungsmuster oder allein um die Effekte diskursiver und kultureller Praktiken, sondern um kritische Interventionen in Heterosexualität als herrschendem Ordnungsmuster, als regulativem Apparat, der die Organisation des sozialen Lebens in kapitalistischen Gesellschaften mit anderen sozialen Verhältnissen (Ethnisierung, Rassismus, Sexismus) verkoppelt.
In diesem Zusammenhang möchte ich – im Gegensatz zum verkürzten bashing gegenüber Konsumgewohnheiten auch schwuler und lesbischer Menschen, das darin schon etwas naiv das Angekommensein in der Heterowelt sehen mag und ein bisschen „politisch korrekt“ daher kommt – mit Hennessy für die Umdrehung der Perspektive plädieren. Die Politisierung der zunehmenden Kommodifizierung des sozialen Lebens und damit die Verschiebung von Artikulationsverhältnissen durch neoliberale Umstrukturierungen bringt das komplexe Geflecht von Identität, Subjektivität, Begehren und Enteignung/Aneignung klarer in den Vordergrund – und rückt damit jede Artikulation von Subjektivität in Bezug zu kapitalistischen Ausbeutungsverhältnissen. Der weiße heterosexuelle Mann und der schwule Manager stehen sowohl in der sozialen Aufmerksamkeit als auch in Hinsicht auf soziale Repräsentation in einem anderen Licht, werden anders kodiert als die heterosexuelle oder lesbische Migrantin, der homosexuelle Migrant. Ohne erneut bestimmte „Positionen“ festschreiben oder verleugnen zu wollen, geht es hier um das Beziehungsgeflecht sozialer Positionen untereinander, das von Hierarchien, Aberkennungsverhältnissen, Unterdrückung, Dominanz von einigen über die ökonomischen und kulturellen Ressourcen von anderen erheblich durchzogen ist. Und: die Konstitutionsbedingungen dieser Subjektivitätsformen hängen miteinander zusammen3. Deshalb, und das zeigt eine queere Perspektive, reicht es nicht, Inklusionspolitiken zu betreiben, weil „Inklusion“ in die bestehenden Zerklüftungen sozialer Ungleichheit stets soziale Differenzen neu hervorbringt und bestätigt. Und es reicht nicht, differenzierte, nebeneinanderstehende Identitätspolitiken zu verfolgen, in denen jede Positionierung repräsentiert würde. Statt dessen kommt es darauf an, den Entstehungszusammenhang, die Artikulationsbedingungen dieser unterschiedlichen sozialen Positionierungen in den Vordergrund zu rücken, die so eben nicht nur eine Frage subkultureller Politiken sind, sondern die Herstellung des Bezugs zur Reproduktion gesellschaftlicher Macht- und Herrschaftsverhältnisse im Ganzen erfordern. Eine einfache Politik der Koalitionen bliebe demgegenüber an der Oberfläche der Phänomene. Hier wird für mich der Angriffspunkt queerer Perspektiven gegen institutionalisierte Formen von Heteronormativität und heterosexuellem Geschlechterregime deutlich, die die bereits genannte Verflochtenheit als Artikulationsbedingung des eigenen Positioniertseins sicht- und kritisierbar machen.
Um es klarer zu formulieren: Es geht um die analytischen Aspekte einer queeren Perspektive als Kritik an Heterosexualität als normativer Identität, deren „Stabilität“ durch die Ausgrenzung anderer Identitäten garantiert wird (die damit auch hervorgebracht werden). Sie hat sich, als Resultat von Kämpfen, modernisiert, und eine immer noch zweigeschlechtliche, wenn auch flexiblere GenderHierarchie etabliert. „Heteronormativität behauptet eine ‚natürliche‘ Entsprechung zwischen biologischem und sozialem Geschlecht und es regiert Begehren entlang einer vergeschlechtlichten Asymmetrie zwischen sexuellem Subjekt (z.B. männlich) und Objektwahl (z.B. weiblich). Gleichzeitig verdinglichen Heteronormen Homosexualität – indem sie das menschliche Vermögen für Empfindungen und soziale Beziehungen (social intercourse) in eine Identität definieren und disziplinieren, die mit den heteronormativen Logiken von Geschlecht (gender) und Begehren, wenn auch pervertiert, zusammenfallen.“4
An dieser Stelle wird klar, warum subversive Politik, die Heteronormativität angreifen will, nicht einfach als „Gegen“standpunkt artikulierbar ist. Die Ökonomie des heteronormativen Begehrens ordnet in den herrschenden Verhältnissen ihr Anderes mit an. Queere Strategien setzen deshalb an dieser Stelle an. Aber was heißt dies für die Frage des Übergangs von analytischer Kritik zu Praxis? Schaut man sich einige Vorschläge aus dem Umfeld der queer studies an, so werden verschiedene Strategien formuliert:
Disidentifikation
Nach Rosemary Hennessy benötigt der Prozess, kollektive Subjekte für sozialen Wandel zu organisieren, „Bewegung“ auf vielen Ebenen, die Formen kollektiven Bewusstseins erfordern. Dieser Prozess arbeite mit/an affektiven Investitionen, die Menschen in die Identitäten, die sie annehmen und leben, leisten. Eine der Voraussetzungen dieses Prozesses ist Disidentifikation – für Hennessy eine Praxis, kritisch nachzuvollziehen, wie wir Identifizierungen, die uns angesonnen werden, annehmen und durch sie leben. Ein befreiendes Potential sieht sie darin, die Folgen und Zwänge historischer Identitäts-Voraussetzungen, die Leiden an bestimmten Lebensformen auslösen, „wegzulernen“5. Nach Hennessy setzt dies voraus, neu zu fassen, wie wir Identitäten in einem nicht verkürzenden historischen Rahmen situieren können, der es erlaubt, auch dieses Leiden als Ergebnis einer Produktionsweise zu sehen, die eine Reihe menschlicher Bedürfnisse leugnet.
Denormalisierung, Enthierarchisierung und Veruneindeutigung
Mit Denormalisierung und Enthierarchisierung verbindet Antke Engel die Möglichkeit, verschiedene Durchsetzungsformen kapitalistisch-heteronormativer Vergesellschaftung sichtbar zu machen und ihnen entgegenzuwirken: die vereindeutigende und oft gewaltsame durchgesetzte Zurichtung von KörperSubjektivitäten für eine rigide zweigeschlechtliche Gesellschaftsordnung; die normalisierende Integration auserwählter sexueller und geschlechtlicher Subjektivitäten und Lebensweisen (qua Markt oder Staat); die diversen sozialen Differenzierungen und Hierarchisierungen, die wahlweise mittels gruppenklassifizierender Kriterien wie sexuellen Vorlieben und Praktiken, Fitness, Gesundheit, Stil oder körperlichen Selbstverhältnissen durchgesetzt werden6. Sie bezieht die beiden Strategien auf rechtliche, ökonomische, soziale und kulturelle Diskriminierungen und Ungleichheitsrelationen, über die unterschiedliche Diskurse und Praktiken miteinander verschränkt sind.
„Enthierarchisierung kann hierbei sowohl als Entprivilegierung normativer Heterosexualität als auch als Anerkennung bislang diskriminierter oder verworfener KörperSubjektivitäten, Praktiken oder Existenzweisen erfolgen. Denormalisierung kann als Anfechtung der sozialen Integrationsnorm bzw. eines assimilatorischen Inklusionsideals vonstatten gehen, aber auch als Abbau struktureller und institutionell abgesicherter sozialer Hierarchien.“7
Veruneindeutigung ist nach Engel der Versuch, den Raum zu schaffen, den es bislang für verworfene Identitäten nicht gibt, und sie statuiert das Recht, Mehrdeutigkeit und Vieldeutigkeit zu leben. „Damit ist VerUneindeutigung eine Strategie, die nicht in der Alternative Identitätspolitik oder Neutralisierung der Differenz gefangen bleibt, sondern geschlechtliche und sexuelle Unterschiedlichkeit als prozessual, kontextuell und konstituiert in Machtverhältnissen, als relationale Singularität oder als différance darstellt.“8 – Es fragt sich allerdings, wie Engels bewusst sehr abstrakt und offen gehaltene Strategie implementiert werden kann in bedeutungsschreibende Prozesse sozialen Handelns, wenn sie diesen Begriff nicht als beschreibend, sondern konzeptuell entwirft und gleichzeitig als soziale Praxis der Dekonstruktion versteht. Hier könnten Diskussionen ansetzen.
Entprivilegierung
Die Strategie der Entprivilegierung, wie sie Corinna Genschel u.a. (2001) vorschlagen, folgt einem ähnlichen Gedanken, das mehr oder weniger sichtbare Gerüst sozialer Privilegierung von Heteronormativität und Zweigeschlechtlichkeit zu unterlaufen. Sie fordern den Perspektivenwechsel weg von einer Fokussierung auf Minderheiten hin zu einer Entprivilegierung der normierten Heterosexualität als einer weitgehend unausgesprochenen Norm, wofür es das permanente Durcharbeiten, „verqueeren“ gesellschaftlicher Herrschafts- und Machtverhältnisse braucht.9
Allen Strategien ist gemeinsam, dass sie eine analytische Vorgabe entwerfen und gleichzeitig auf die Praxis bezogene Überlegungen anstellen, die einen Prozess, eine neu zu verstehende und zu entwerfende Praxis gegenüber einer Gegen-Identität betonen. Hier stellt sich die Frage nach der Beteiligung veränderter Subjektivitäten und Subjektivierungsformen bei der Transformation gegenwärtiger hegemonialer Macht- und Herrschaftsverhältnisse. Sind diese Strategien zu eng auf Subjektivierungsprozesse gerichtet und versuchen davon ausgehend, den Gesamtzusammenhang widersprüchlicher gesellschaftlicher Interessen, Institutionen und Kräfteverhältnisse abzubilden? Sicher wäre dies eine Verkürzung, mit der unreflektiert vorausgesetzt würde, dass die Veränderung von Subjektivitäten und Subjektivierungsweisen – auch als widerständige – lediglich Mechanismen der jeweiligen Herrschaftsverhältnisse sind, in deren Rahmen sie entstehen.10
Überlegungen zu queeren Praxen
Die Frage ist, wie Selbst- und Fremdverhältnisse sich verändern, verändert werden. Dabei verschränken sich zwei Tendenzen auf paradoxe Weise ineinander: Aus sozialen Bewegungen wie der schwul-lesbischen entsteht auf Grund der Einsicht, dass homogenisierende Identitätspolitiken Ausschlüsse produzieren, differenziertes, queeres Wissen über die Variation, Beweglichkeit und Unabgeschlossenheit von Gender-Identitäten. Gleichzeitig erodieren kollektive Identitäten unter dem neoliberalen Druck zugunsten von Individualisierung, Leistungsdruck und Verwertbarkeit und scheinen mehr und mehr unverbunden nebeneinander zu stehen.
Vielleicht liegt hierin nicht nur ein Problem, sondern auch der Ansatzpunkt für praktische Überlegungen, in welchen sozialen Beziehungen und Räumen Platz für Neuentwürfe und Ausprobieren genannter und anderer Strategien ist. Einerseits haben dies politische Praxisformen wie das Summercamp-Projekt oder auch Pink Silver als bewegungsorientierte Intervention aus queerer Sicht versucht11. Andererseits gibt es langjährig etablierte kollektive Formen, die eigene Identität und Identitätszumutungen von außen erneut spielerisch, ironisch und als Wieder- bzw. Neubesetzung von identitätspolitischen Zuschreibungen umzuarbeiten. Ein gutes Beispiel, um es mit Nancy Wagenknecht (2002) zu sagen, ist der Kreuzberger Gegen-CSD, der aus Protest gegen die zunehmend kommerzialisierte und normierte Ablaufform des CSD in Berlin entstanden ist: Die dissidenten CSD-Organisierungen der vergangenen Jahre zielen auf zivilgesellschaftliche Auseinandersetzungen, die eine Kritik des Staates einschließen und Widerspruchsverhältnisse in den Blick nehmen, die (auch) die gesellschaftliche Formierung von Sexualitäten durchziehen. Der Kreuzberger CSD repräsentiert in der sichtbaren Vielfalt der Anwesenden und in den Verweisen auf Verhältnisse, die ihre Subjekte als verschiedene hervorbringen, kein von Vornherein einheitliches Subjekt. „Die Herstellung dieser Gemeinsamkeiten wiederum hängt ab von herrschenden Kräftekonstellationen und deren politischer Deutung – also von politischen Orientierungen und Utopien genauso wie von den Möglichkeiten, diese zu leben.“12
Schließlich aber geht es nicht nur um öffentliche, subversive Inszenierungen, sondern z.B. auch um das Terrain von Freundschaften als politischer, nicht nur privater Ressource. Nancy Wagenknecht und ich haben in diesem Sinne dafür plädiert, Netzwerke zu entwickeln, die der aneignenden, formierten Form affektiver Bedürfnisse einen anderen Raum eröffnen. Jenseits der Gretchenfrage: „Und wo gehörst Du hin?“ sollte es unseres Erachtens darum gehen, eine Praxis zu entwickeln, in der nicht nur die identitätspolitischen Effekte heteronormativer Subjektivitäten erfühlt, besprochen, weggelernt und auf neue Weise erfunden werden können, sondern auch Praxen entstehen, die nicht mehr nur das „Nicht“ als Basis haben.
Vielleicht kann man es zum vorläufigen Abschluss so sagen: Kritiken an neoliberalen Veränderungen von identitätspolitisch überformten Vergesellschaftungsformen auch von sexuellen und GenderIdentitäten können nicht nur als Abwehrkämpfe gegen bestehende herrschaftsförmige Ent- und Aneignungen von Gefühlen, Bedürfnissen und körperlichen Befindlichkeiten gefasst werden, weil sie kraftzehrend und letztlich auch destruktiv verlaufen. Es geht immer zeitgleich um die Neuerfindung einer Praxis, die in der minimalen Gemeinsamkeit nach der Suche neuer kollektiver Formen solidarisch über diese Zwänge hinwegzukommen versucht.