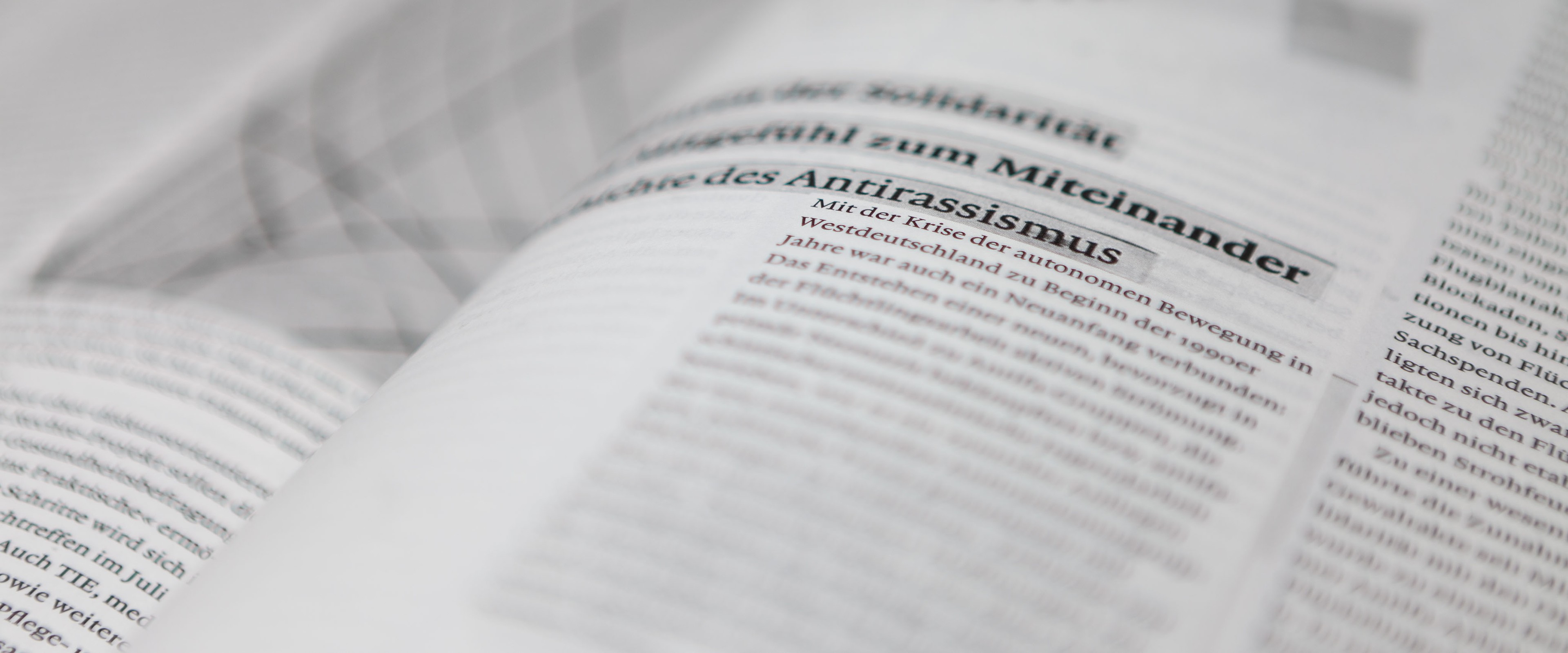Obwohl internationale Solidarität für die Autonomen in diesen Jahren einen herausragenden Wert darstellte, war praktizierte Solidarität mit Flüchtlingen für sie nicht selbstverständlich. Dies lag unter anderem daran, dass der traditionelle linke Internationalismus in der BRD vor allem Solidarität mit Linken in anderen Ländern war, anders als etwa in den USA, Frankreich oder Großbritannien, wo er sich weit stärker auch auf dort lebende ethnische Minderheiten bezog. Deutsche Solidaritäts-Komitees unterstützten in der Regel bestimmte Parteien oder Gruppierungen im Ausland und leisteten ansonsten, vor allem über Medico International, humanitäre Hilfe, die mit Flüchtlingen in der BRD nur dann zu tun hatte, wenn Mitglieder der unterstützten Gruppierungen hier im Exil lebten.
Erst die Einrichtung von Sammellagern für Flüchtlinge im Jahre 1982 führte in weiten Teilen der linken, liberalen und humanitär eingestellten Öffentlichkeit zu Protesten: von Öffentlichkeitskampagnen und Flugblattaktionen über Demonstrationen, Blockaden, Sitzstreiks oder militanten Aktionen bis hin zu unmittelbarer Unterstützung von Flüchtlingen durch Geld- oder Sachspenden. An diesen Aktivitäten beteiligten sich zwar sehr viele Autonome, Kontakte zu den Flüchtlingen selbst wurden jedoch nicht etabliert. Die Protestaktionen blieben Strohfeuer.
Zu einer wesentlichen Veränderung führte die Zunahme fremdenfeindlicher Gewaltakte seit Mitte der 1980er Jahre. Solidarität mit den Opfern rechter Gewalt wurde zu einem festen Bestandteil autonomer Antifa-Arbeit. Hierbei spielten die Flüchtlinge jedoch lange eine passive Rolle. In erster Linie wurden sie als »die zu Beschützenden« betrachtet und oftmals wohlwollend bevormundet.
Als nach den Brandanschlägen von Saarbrücken und Hünxe und dem Pogrom von Hoyerswerda im Herbst 1991 bundesweit eine Welle rassistischer Gewaltakte einsetzte, begann in der autonomen Szene eine allgemeine Mobilisierung zur »Verteidigung von Flüchtlingen« und zum Aufbau antirassistischer Strukturen. Sie reichte weit über die Personenkreise hinaus, die bis dahin wenigstens peripher Kontakt zu Flüchtlingen hatten. In zahlreichen Städten gründeten sich Antirassismus-Gruppen, wurden Notruftelefonketten organisiert. Zum Fanal wurde die Kirchenbesetzung in Norderstedt im Jahr 1991. Eine Gruppe von Flüchtlingen war nach rassistischen Ausschreitungen aus dem ihnen zugewiesenen Wohnheim in Greifswald geflohen und hatte die Shalomkirche in Norderstedt besetzt. Bundesweit unterstützten Autonome die Kirchenbesetzung, die trotz repressiver Maßnahmen der Landesregierung 18 Wochen lang aufrecht erhalten werden konnte. Trotz mangelnder Rücksichtnahme autonomer Gruppen auf die Belastbarkeit der Gemeindemitglieder gelang die Kooperation zwischen Autonomen und Nordelbischer Kirche. Seit Norderstedt tickten die Uhren anders. Die Bereitschaft von Gemeinden, Kirchenasyl zu gewähren, nahm deutlich zu. Das Verhältnis der neu entstandenen Antirassismus-Gruppen zu den Flüchtlingen war grundlegend anders.
Im Zusammenhang mit der Bundestagsdebatte 1993 um die Reform des Asylrechts, die dessen faktische Abschaffung bedeutete, wurde bundesweit zur Blockade des Bundestags mobilisiert, an der sich der größte Teil der autonomen Bewegung sehr aktiv beteiligte. Für die meisten Gruppen wurde diese Kampagne, die mit zahlreichen dezentralen Aktionen wie Kundgebungen, Demonstrationen, Mahnwachen, Straßentheater und Öffentlichkeitsarbeit verbunden war, zeitweise zum Schwerpunkt ihrer politischen Arbeit. Die Antirassismusgruppen hatten in dieser Zeit gewaltigen Zulauf.
Doch die ständige Verschiebung der Bundestagsabstimmung führte dazu, dass die Unterstützung vieler Gruppen und Einzelpersonen schon vor dem endgültigen Termin am 26. Mai 1993 wegbrach. Seitdem war praktische antirassistische Arbeit, beispielsweise in Form von Gutscheinumtausch oder Hilfe beim Kampf mit bürokratischen Hürden, fast nur noch für die Antirassismusgruppen relevant, die hauptsächlich mit kirchlichen oder humanitären Gruppen zusammenarbeiteten. Damit entfernten sich die linken Antirassismusgruppen vom sozialen und thematischen Bezugsrahmen der übrigen autonomen Szene: Kirchliche, humanitäre und linksliberale Gruppen sowie »Hauptamtliche» wurden zu Dauerbündnispartnerinnen, mit denen man mehr zu tun hatte als mit anderen autonomen Gruppen.
Das Selbstverständnis antirassistischer Politik
Das politische Selbstverständnis der meisten Antirassismusgruppen ist ein Spiegel aller Strömungen und Richtungen innerhalb des undogmatisch–linken Spektrums; dennoch sind postoperaistische Positionen bei vielen Gruppen von großer Bedeutung. Aus dieser Position heraus wird internationale Solidarität nicht mehr ausschließlich als Solidarität mit Befreiungsbewegungen begriffen. Als praktische Solidarität mit Flüchtlingen, Asylsuchenden und Illegalisierten bezieht sie sich insbesondere auf gemeinsame Alltagskämpfe.
Der bis Anfang der 1990er oft gepflegte Militanzfetisch vieler autonomer Gruppen wurde deutlich kritisiert. Darüber hinaus wurde in der Zusammenarbeit mit Flüchtlingen ganz bewusst versucht, gemeinsame Perspektiven zu entwickeln. Teilweise bedeutete eine engere Zusammenarbeit mit Flüchtlingen auch eine politische Öffnung für Menschen mit beispielsweise kirchlichem Hintergrund und eine partielle Abkehr von oft als hierarchisch und sexistisch wahrgenommenen eigenen Szenestrukturen. Im Rahmen der Anfang der 1990er geführten linken Selbstverständnisdiskussionen wurden auch projektive Haltungen und falsche »Heilserwartungen« hinsichtlich der Flüchtlingssolidarität kritisiert. So gab beispielsweise die autonome l.u.p.u.s–Gruppe aus Frankfurt/Main eine Streitschrift unter dem Titel »Geschichte, Rassismus und das Boot. Wessen Kampf gegen welche Verhältnisse?« heraus, in der die Notwendigkeit antirassistischen Handelns betont, die zugrunde liegenden Motivationen aber hinterfragt wurden. So hatte die radikale Linke den seit Ende der 1980er laufenden rechten Kampagnen gegen »die Asylantenflut!« die Parole »Für freies Fluten!« entgegengesetzt und die Ankunft von Asylsuchenden lautstark begrüßt. Daran waren teilweise sozialrevolutionäre Hoffnungen geknüpft worden. Nicht Riots von rechts, wie sie sich in Hoyerswerda und Rostock gegen die Flüchtlinge entwickelten, sondern ein soziales Aufbegehren der in Lager eingezwängten Flüchtlinge und kraftvolle Flüchtlingsrevolten waren von einigen sozialrevolutionären Autonomen erwartet worden. Dies wurde mit der Hoffnung verknüpft, dass deutsche Linke und Marginalisierte außerhalb der Linken von aufstands- und bürgerkriegserfahrenen Flüchtlingen »kämpfen lernen« würden. Diese Haltung geriet als positiver Rassismus in die Kritik. Sie galt zudem als projektive Hoffnung einer Linken, der eine eigene Perspektive in sozialen Kämpfen weitgehend fehlte.
Kontinuität der Strukturen
Waren die 1990er durch Kampagnenarbeit geprägt, bei der kurz- und mittelfristig zu Demonstrationen und anderen öffentlichkeitswirksamen Aktionen mobilisiert wurde, so hat sich im letzten Jahrzehnt eine bemerkenswerte Kontinuität antirassistischer Solidarität entwickelt. Das Netzwerk »Kein Mensch ist illegal« (KMI), in welchem seit 1997 die Solidaritätsarbeit für illegalisierte Flüchtlinge und sans papiers in Deutschland koordiniert wird, organisiert langfristig und gruppenübergreifend sowohl Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit als auch materielle Unterstützungsarbeit. Mit der Karawane für die Rechte der Flüchtlinge und MigrantInnen wurde ein weiteres, mit KMI verzahntes Netzwerk geschaffen, in dem sich Flüchtlinge selbst organisieren. Neben der Bekämpfung von Rassismus liegt ein weiterer Schwerpunkt insbesondere auch in einer antisexistischen Ausrichtung, womit die Karawane zu einem festen Anlaufpunkt für Opfer sexualisierter Gewalt wurde.
Neben regionalen Flüchtlings- und MigrantInnenselbsthilfeorganisationen, die von Flüchtlingen getragen werden, aber auch anderen die Möglichkeit der Mitgliedschaft einräumen, gibt es mit The Voice eine überregionale Flüchtlingsselbstorganisation mit explizit linksradikalem Anspruch, in der vorwiegend Menschen aus dem englischsprachigen Teil Afrikas aktiv sind. Zwischen Antirassismusgruppen und diesen Organisationen gibt es immer wieder Zusammenarbeit und mittlerweile auch Kontinuitäten in der Kooperation, doch konnte die ursprüngliche Intention vieler AntirassistInnen, zu einer dauerhaften engen Zusammenarbeit, gemeinsamen Perspektiven und schließlich einem Verschmelzen »deutscher« und »migrantischer« Zusammenhänge und antirassistischer und allgemeiner sozialer Kämpfe zu finden, nicht realisiert werden. Andererseits gibt es nach wie vor »gemischte« antirassistische Gruppen, in denen allerdings Flüchtlinge und MigrantInnen als Einzelpersonen oder Kleingruppen deutlich in der Minderzahl sind.
Auch Kampagnenarbeit verläuft heute eher in Strukturen der Kontinuität. Deutlich wird dies etwa an der Zentralen Aufnahmestelle (ZASt) Bramsche-Hesepe in Niedersachsen oder an der Abschiebehaftanstalt Büren in Nordrhein-Westfalen, wo Demonstrationen für die Aufhebung der Anstalten, Öffentlichkeitsarbeit über die dortigen Lebensbedingungen und Unterstützung der Flüchtlinge selbst eine Einheit bilden. Ganz allgemein besteht aktuelle Antirassismus-Arbeit aus sehr vielen alltäglichen Dingen, bei denen der Übergang in ehrenamtliche Flüchtlingssozialarbeit wie Hausaufgabenhilfe und Sportkurse für Flüchtlingskinder oder Organisation medizinischer Betreuung für Illegalisierte fließend ist.
18 Jahre nach dem Entstehen der Antirassismusgruppen als eigenständige Kraft stellt sich die Frage nach dem »wie weiter«. Es lässt sich weder von einem Scheitern ihrer politischen Arbeit noch von einem Erreichen ihrer Ziele sprechen, eher davon, dass der tägliche mühselige Alltag die Notwendigkeit eines antirassistischen Engagements zeigt, die Arbeit der Antirassismusgruppen aber oftmals »nur« eine etwas radikalere und politisch anders reflektierte und begründete Form der Arbeit von Wohlfahrtsverbänden darstellt. In Folge der aktuellen Wirtschaftskrise ist mit einer restriktiveren Sozialpolitik zu rechnen. Falls es zu einer Verschärfung der Hartz-Gesetze kommt, wird die Verschärfung des Asylbewerberleistungsgesetzes folgen, allein schon, um den materiellen Abstand zwischen den unterschiedlichen Gruppen von Leistungsbeziehern zu wahren, auf dem der implizite Sozialrassismus des deutschen Gesellschaftssystems basiert. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob der gemeinsame Kampf für soziale globale Rechte in naher Zukunft tatsächlich wieder eine Perspektive bekommt.