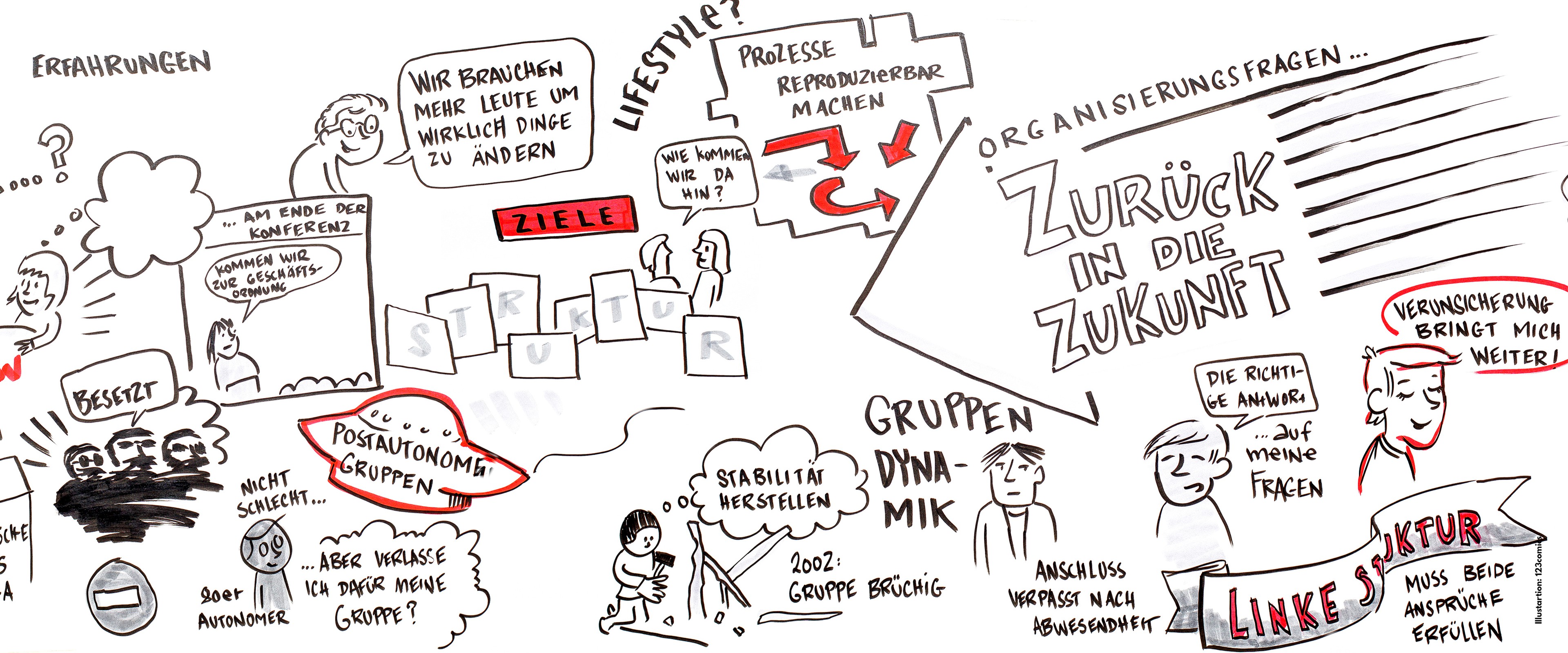«you have to act as if it were possible to radically transform the world. and you have to do it all the time.»
Angela Davis
*
«Du musst handeln, als ob es möglich wäre die Welt radikal zu verändern. Und du musst es jederzeit tun.»
Angela Davis
(Übersetzung von der Redaktion)
Alternative und queere Lebensmodelle gibt es durchaus, aber sie sind leider weit davon entfernt, Normalität für alldiejenigen zu sein, die anders leben wollen. Zudem erleben wir Phänomene wie die „Besorgten Eltern“, den anti-feministischen „Marsch für das Leben“, homophobe Massendemonstrationen in Frankreich und stolpern immerzu über dieses ominöse „Gender“ als Feindbild in den Zeitungen und Köpfen.Wir wollten wissen wo wir stehen und haben deshalb eine Selbstbefragung durchgeführt (Genaueres dazu in unserem Artikel in der arranca! #48). Unser Ziel war es, Austausch und Diskussionen anzustoßen und uns mit den folgenden Fragen zu beschäftigen:
Wo stehen wir gerade? Wo und wie wird Widerstand im Alltag gelebt? Und welche Rolle spielt der konservative Rollback, der sich gerade abzeichnet? Während private Lebensentwürfe also einerseits mehr Spielräume enthalten, werden die Unsicherheiten, sobald Leute alte Wege verlassen, immer größer. Anstatt Experimente zu wagen, greifen viele daher gerade im Privaten auf tradierte Lebens- und Familienmodelle zurück. Doch was bedeutet der Rückzug Vieler ins Private? Ist es der Wunsch nach trauter Zweisamkeit oder die Angst vor der prekären Außenwelt?
Dass das Private als ein Rückzugsraum gesehen wird, ist in Anbetracht der Tatsache, dass einst hart dafür gekämpft wurde, das Private als politisches Terrain zu begreifen, eine ziemliche Kehrtwende.
Ist das Private noch politisch? Oder nur noch ein Exil?
Wir sehen in diesem Rückgriff auf tradierte Lebens- und Familienmodelle bei einem Mehr an Freiheiten und Spielräumen eine Diskrepanz von Utopie und gelebter Wirklichkeit, die wir auch in unserer Selbstbefragung wiedergefunden haben. Dabei haben wir uns und über 300 Leute dazu befragt, wie wir leben wollen und welche Hindernisse es dabei gibt. Wir haben nach den größten Ängsten gefragt und danach, wie die Teilnehmer*innen im Hier und Heute leben. Drei große Schwerpunkte strukturierten die Befragung:
- Das Leben im Alter
- Leben mit Kindern und Bilder von Familie
- Die Sorge um sich und andere
Wir wollten wissen, welche Rolle verschiedene Formen von Kollektivität im Alltag spielen: Ob es sie gibt und wie sie genau aussehen, ob sie wirklich gelebt werden oder eher eine schöne Utopie sind.
Die Ergebnisse waren recht ernüchternd. Viele haben Angst vor der Einsamkeit im Alter und davor sich eine menschenwürdige Pflege nicht leisten zu können. Denn in der klassischen Form der Kleinfamilie wird, sind die Kinder einmal aus dem Haus, eine*r übrig bleiben. Die damit einhergehende Gefahr von gesellschaftlicher Isolation und Ausgrenzung wurde von vielen als durchaus real betrachtet, und eigentlich blickte kaum eine*r der Befragten optimistisch auf das Alter. Da sich die Frage, wie wir im Alter leben wollen, nicht von der nach dem "Leben jetzt" trennen lässt, gab es auch in unserer Befragung immer wieder große Überschneidungen. Zwar war die Vorstellung von einem kollektiven, generationsübergreifenden Zusammenwohnen für viele ein möglicher Ausweg aus dem Dilemma der drohenden Einsamkeit im Alter. Dem gegenüber stand jedoch die große Angst, dass kollektive Strukturen auf Dauer nicht funktionieren. Es mangele vor allem an Sicherheit und Verbindlichkeit, sowohl in rechtlicher als auch in finanzieller Hinsicht. Dem gegenüber gilt die Kleinfamilie noch immer als relativ sicherer Raum – von finanziellen Vorteilen und einem höheren Maß an Verbindlichkeit durch rechtliche Verantwortlichkeiten füreinander, bis hin zum gesetzlich geregelten Anspruch auf Unterhaltszahlungen im Falle einer Trennung*.
Vor allem die befragten Alleinerziehenden wünschten sich mehr Kollektivität im Alltag. Sofern sich Kinder und Beruf überhaupt vereinbaren lassen, bleibt daneben kaum Zeit für eigene Interessen. Sie fühlten sich isoliert und auf den engsten Freundes- und Familienkreis angewiesen, vor allem bei akuten zeitlichen Engpässen. Wirklich geregelte Strukturen geteilter Verantwortung jenseits der klassischen Elternrollen haben nur sehr wenige der Befragten für sich etablieren können*.
Für eine solche Vereinzelung sind auch die rechtlichen Rahmenbedingungen als ursächlich zu nennen. Elternschaft wird rechtlich immer noch vor allem als Gesamtpaket biologischer, rechtlicher und sozialer Elternschaft gedacht und als solche privilegiert. Die Stiefkindadoption bei Eingetragenen Lebenspartnerschaften scheitert immer wieder an behördlichen Hindernissen, und Alleinerziehende werden vor allem auch steuerlich benachteiligt, sodass die Notwendigkeit, viel Zeit der Lohnarbeit zu widmen, noch steigt und immer weniger Zeit für Gemeinschaft übrig bleibt. Dass kollektivere Modelle, Verantwortung nicht nur für die eigenen Kinder oder Mitglieder der eigenen Herkunftsfamilie zu übernehmen, rechtlich nicht abgesichert sind, ist also ein eklatanter Missstand.
Denn wir sind alle mehr oder weniger auf Sorge durch andere angewiesen. Die Anlässe sind vielfältig, doch die Spielräume, diese Sorge kollektiv zu organisieren, sind der Erfahrung der Befragten nach oft eher gering. Entsprechend wurden daher Strategien genannt, die Leute für sich selbst anwenden können und die dazu dienen, möglichst nicht in die Situation zu gelangen, auf Sorge durch andere angewiesen zu sein. Dazu gehören vor allem Selbstoptimierung durch Sport, Fitness und Erholung durch "quality time". Dass es sich dabei um einen neoliberalen Leistungsimperativ handelt, war den meisten der Befragten dabei vollkommen bewusst. Doch wie geht es anders und zusammen mit anderen? Kollektiv wird Sorge meist über gemeinsame Wohnräume mit Haus-/Mitbewohner*innen organisiert. Dies ist in der Praxis jedoch oft wenig verlässlich, wenn die Situation die Sorge durch andere erfordert und ernster oder länger wird. Dann fällt die Organisation nämlich in der Regel auf familiäre Strukturen zurück.
Was aber passiert, wenn die eigene Familie nicht in derselben Stadt oder demselben Land wohnt oder Menschen den Kontakt zu ihrer Herkunftsfamilie abgebrochen haben? Hinter diesen und anderen Fragen steht die Angst davor, mit der Sorge um sich oder andere alleine gelassen zu werden. Die Sorge für Kinder ist dafür ein gutes Beispiel: Rechtlich ist es zum Beispiel so geregelt, dass eine Krankschreibung nur für sich selbst oder die eigenen Kinder funktioniert. Freund*innen oder die Wahlfamilie zu pflegen, ist in diesem System nicht vorgesehen. In der Regel wird mensch also auf die rechtliche Herkunftsfamilie zurückgeworfen. Auch im Bereich der CareArbeit und Sorge um sich selbst sehen sich viele Menschen auf sich allein gestellt oder auf den engsten Kreis der Herkunftsfamilie zurückgeworfen, die dies nicht immer leisten kann.
Gleichzeitig ist die Pflege anderer Personen sowohl gesellschaftlich als auch finanziell eher selten als Arbeit und wichtiger Teil des Zusammenlebens anerkannt*. So sind Pflege und Lohnarbeit finanziell und zeitlich oft nicht zu vereinen. Überforderung und das Gefühl, mit der Pflege alleine gelassen zu werden, sind das Resultat. Die Empfindung von Einsamkeit wird zudem dadurch erhöht, dass Pflege in der Regel zu Hause oder in anderen privaten Räumen passiert, wenn die Gepflegten beispielsweise in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Auch hier sind rechtliche Modelle auf die Pflege durch die Herkunftsfamilie beschränkt und/oder nur mit hohen finanziellen Ressourcen zu bewältigen. So ist der etwas zynisch betitelte „Pflegeurlaub“ zeitlich begrenzt, und bei einer länger- oder dauerfristigen Pflege fällt der Lohn weg. Der Weg in prekäre Abhängigkeiten wird dadurch beschleunigt, dass das reguläre Pflegegeld eigentlich nicht ausreicht, um Leistungen komplett zu finanzieren. Entsprechend war der Wunsch nach kollektiver Organisation von Sorge und Pflege im Alltag und im Hinblick auf Altern sehr groß.
Sind die Befragungsergebnisse Ausdruck eines konservativen Rollbacks oder doch nur ein letztes Aufbäumen vor dem unvermeidlichen Untergang althergebrachter Rollenbilder? Viele der Befragten waren weit davon entfernt, nach ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen zu leben. Obwohl der Wunsch nach Formen von Kollektivität jenseits der Kleinfamilie da ist, bleibt er oft utopisch. Wir haben daraus den Schluss gezogen, dass eine politische Strategie von zwei Seiten ansetzen muss: zum einen muss Absicherung, sowohl rechtlich als auch finanziell, erkämpft werden. Denn nur so entsteht der Raum, in dem mit Vorstellungen und Wünschen experimentiert und diese Realität werden können.
Wer sich bisher für ein Modell wie die Co-Elternschaft entscheidet, begibt sich in einen quasi rechtsfreien Raum jenseits von Unterhaltszahlungen oder auch nur gemeinsamer steuerlicher Einstufung – solange er*sie nicht Hartz IV empfängt. Die Subventionierung von einem Leben mit Kindern muss unabhängig von der Familienform, Anzahl der Eltern usw. geschehen! Wer die Sorge für ein Kind jenseits von biologischer Elternschaft und Adoption übernimmt, sollte genauso finanziell unterstützt werden. Bislang jedoch laden weder die rechtlichen, noch die steuerlichen Rahmenbedingungen zum Experimentieren ein – man muss es sich derzeit also leisten können! In dieser Hinsicht ist Deutschland verhältnismäßig rückständig. So ist es etwa in Kanada möglich, dass sich bis zu vier Personen das Sorgerecht vertraglich teilen und so zu gleichberechtigten Partner*innen werden können.
Zum anderen sollen Akteur*innen, die diese Utopien leben, sichtbarer gemacht werden - denn es gibt sie! Solidarische Ökonomien, Modelle von Co-Elternschaft, Mehrgenerationenwohnen und Alten-WGs sind Beispiele, die uns bei der Selbstbefragung begegnet sind. Die Möglichkeiten von alternativen Familienmodellen und Formen des Zusammenlebens im Hier und Jetzt sind ein Weg, vermeintliche Normalitäten und Natürlichkeiten zu dekonstruieren. Es ist wichtig zu zeigen, dass es ein Leben jenseits der Kleinfamilie und der Heteronorm gibt.
Wir müssen uns immer wieder bewusst werden, dass bereits vieles erkämpft wurde. Bereits geführte Kämpfe und Auseinandersetzungen waren und sind die Grundlage, auf die wir weiter aufbauen wollen und zum Ausgangspunkt jetziger und zukünftiger Kämpfe erklären. Die oft geäußerte Unterstellung einer schon erreichten Geschlechtergerechtigkeit ist hingegen zentraler Ausdruck eines konservativen Rollbacks. Wir sollen schön zufrieden sein mit dem, was wir haben. Aber uns mit dem Status Quo zufrieden zu geben kommt uns nicht in den Sinn! Vielmehr gilt es jetzt umso mehr, auf die Ausweitung und das Neuerkämpfen von Anerkennung, Wertschätzung und Aufwertung unserer alltäglichen Baustellen zu pochen: dem Leben mit Kindern, alternativen Familienmodellen, dem Leben im Alter und der Sorge um uns selber und um andere.
Denn ja, das Private ist politisch!