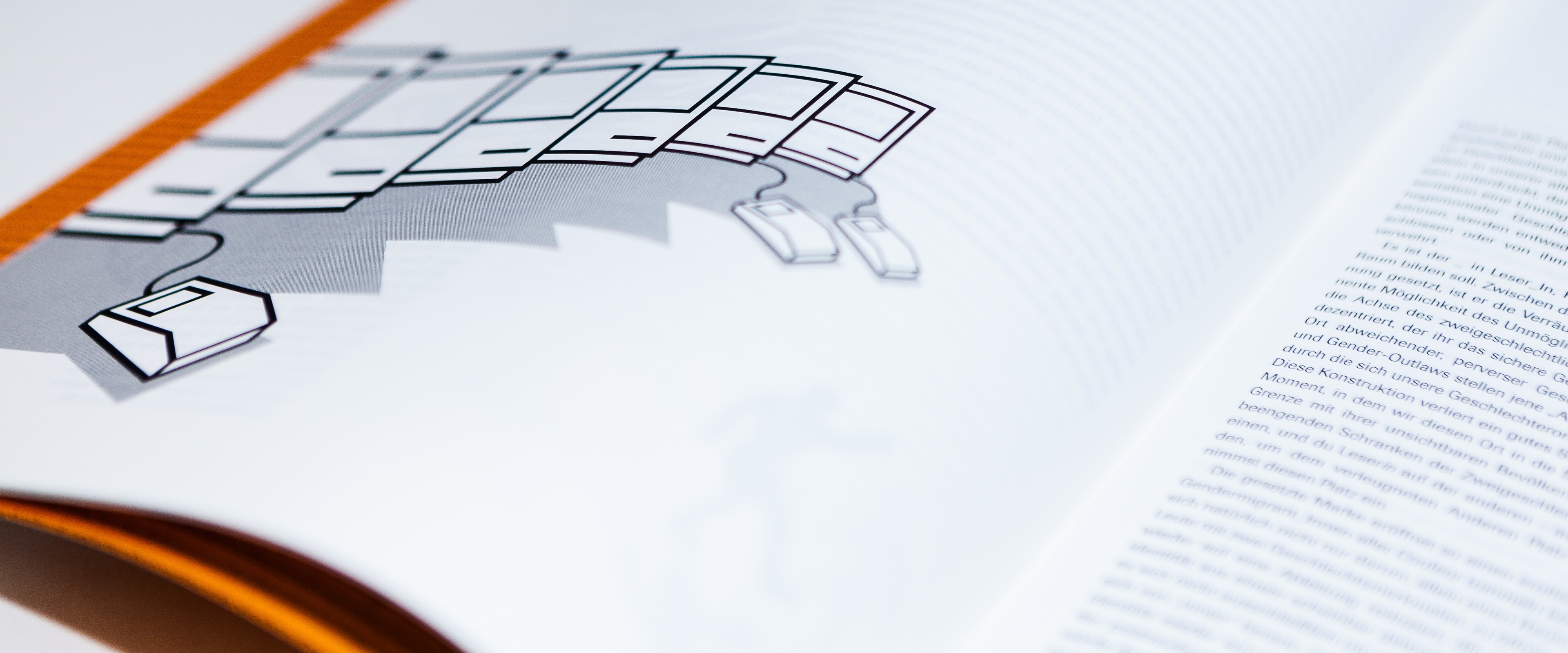Damit ist der Platz markiert, den unsere Sprache nicht zulässt, ein Raum spielerischer und erotisch-lüsterner Geschlechtlichkeit, den es in unserer Geschlechterordnung nicht geben darf1. Genderbending2 wird nicht allein in unserer alltäglichen Praxis immer wieder zensiert und gewaltsam unterdrückt, darüber hinaus bildet auch seine sprachliche Repräsentation eine Unmöglichkeit. Alle, die sich nicht unter die beiden Pole hegemonialer Geschlechtlichkeit subsumieren lassen wollen und können, werden entweder aus diesem Repräsentationssystem ausgeschlossen oder von ihm vereinnahmt - ein eigener Ort bleibt uns verwehrt.
Es ist der _ in Leser_In, Freund_In, Liebhaber_In, der genau diesen Raum bilden soll. Zwischen die Grenzen einer rigiden Geschlechterordnung gesetzt, ist er die Verräumlichung des Unsichtbaren, die permanente Möglichkeit des Unmöglichen. Mit dieser Sichtbarmachung wird die Achse des zweigeschlechtlichen Imaginären auf jenen Punkt hin dezentriert, der ihr das sichere Gefühl der Normalität versagt: auf den Ort abweichender, perverser Geschlechtlichkeit. Transgender-People und Gender-Outlaws stellen jene «Abweichungen» von Geschlecht dar, durch die sich unsere Geschlechterordnung ihrer Normalität versichert. Diese Konstruktion verliert ein gutes Stück ihrer Schlüssigkeit in jenem Moment, in dem wir diesen Ort in die Sprache eintreten lassen: _. Die Grenze mit ihrer unsichtbaren Bevölkerung wird zum Ort, indem die beengenden Schranken der Zweigeschlechtlichkeit – du Leser auf der einen, und du Leserin auf der anderen – auseinander geschoben werden, um dem verleugneten Anderen Platz zu machen: du Leser_In nimmst diesen Platz ein.
Die gesetzte Marke eröffnet so einen erotischen Raum, in dem sich Gendermigrant_Innen aller Couleur tummeln können. Dabei handelt es sich natürlich nicht nur darum, allein einen Raum für Intersexuelle, also Leute mit zwei Geschlechtsmerkmalen, zu öffnen. Damit wäre der Raum wieder auf eine Ableitung reduziert, die Ableitung der Geschlechtsidentität aus einem scheinbar determinierenden Körper. Auch handelt es sich nicht ausschließlich um einen Raum für diejenigen von uns, die sich von «innen» heraus «anders» fühlen; damit wäre die Geschlechtsidentität wieder auf einen Raum dubioser Innerlichkeit reduziert, den der postmoderne Feminismus zur Genüge dekonstruiert hat. Beides würde den politischen Charakter von queer nicht einholen, denn mit der gesetzten Marke _ ist auch ein politischer Raum widerständiger Praktiken eröffnet, der keine Voraussetzungen macht. Queer kann nicht echt sein, es gibt nichts, was die Authentizität von queer legitimiert. Queer heißt einzig und allein «performing the gap», den _ zu leben.
Damit soll nicht der queere Körper per se zum Politikum gemacht werden3. Die Aneignung queerer Lebensweisen muss weiterhin mit einer linksradikalen Position verknüpft bleiben, wenn sie eine radikale Gesellschaftskritik sein möchte. Doch zunächst muss klar sein, was es überhaupt bedeutet, sich ein queere Position zu eigen zu machen. Ich kehre daher zur Frage zurück: Was kann es heißen, sich diesen _ anzueignen?
Trans ...?
Der Überblick im Park neuer Subjektivitäten kann einem schnell verloren gehen, denn Attribute wie transsexuell, transidentitär oder transgender werden gerne und oft als wechselseitig austauschbare Begriffe benutzt. Mir geht es nicht darum, dieses Spiel still zu stellen oder durch Definitionen einzugrenzen. Ich möchte lediglich die hegemoniale Konstruktion transsexueller Positionen etwas näher betrachten. Transsexuelle haben in Frage gestellt, dass unser Körper auf ewig einem Geschlecht angehören muss. Körper sind für sie nicht länger jene festen und immergleichen Materialitäten, mit denen wir geboren werden, sondern form- und dehnbare Einheiten, die durch Crossdressing, Hormone und Operationen angeeignet werden können. Statt jedoch die daraus entstehenden Geschlechtlichkeiten zuzulassen, zwingen medizinische und juristische Standards zu binärer Eindeutigkeit4, gegen den Willen vieler Transsexueller, die gerne darauf verzichten würden, ihren Körper dem je gewünschten Geschlecht anzupassen. Als transsexuell gelten nach herrschender Definition aber nur diejenigen, die eine vollkommene Umwandlung von female to male (ftm) oder male to female (mtf) vornehmen. Der Signifikant dieser Vollkommenheit kann in einer heteronormativen Gesellschaft natürlich nur das Genital sein. Vagina und Penis werden einmal mehr als jene Merkmale aufgeladen, die Frau- oder Mann-Sein ausmachen. Warum eine mtf-Transsexuelle, die schon längst als Frau durchgeht, erst nach dem operativen Eingriff eine amtlich «echte» Frau ist, bleibt dabei hinter einem Berg bürokratischer Maßnahmen und Regelungen verborgen.
Das widerständige Potenzial dieser Aneignungsform ist daher sehr begrenzt. Sie führt zwar einen Bruch in die Logik natürlicher Körper ein, indem sie die lebenslange Zugehörigkeit zu einem Geschlecht hinterfragt, vermag deren Strukturierung aber nicht zu überwinden. Der Raum, den wir oben versucht haben einzuführen, existiert für Transsexuelle nur als ein Transitraum. Es ist für sie nicht möglich, sich zwischen den Grenzen hegemonialer Geschlechtlichkeit niederzulassen. Stattdessen geht es gezwungenermaßen darum, diese Grenzen möglichst sauber und unauffällig zu überwinden. Die konstruierte Transsexuelle ist eine TransITsexuelle. Sie durchquert oder kreuzt den _ zwischen den Polen hegemonialer Geschlechtlichkeit, ohne die Möglichkeit zu haben, diesen Raum dauerhaft zu besetzen.
Cyborg-Szenarien und queere Lüste
In einer queeren Perspektive geht es aber genau darum, in diesen Raum zu floaten und dort zu verweilen, sich die dort liegenden Geschlechtsmöglichkeiten zu Eigen zu machen und sich darin zu räkeln und auszutoben. Aneignung bedeutet hier: Einen Raum der Lust, des Unbekannten und des experimentellen Spiels zu durchstreifen; sich einer Veränderung hinzugeben, deren Ende unbestimmt ist. Queer oder transig zu sein heißt, nicht mehr in die traditionellen Konzepte von Körper, Geschlecht und Begehren zu passen; es heißt, traditionelle Bilder zu entgrenzen. Eine Vorstellung, die Donna Haraway mit der berühmten Metapher der Cyborg belegt hat. Die Cyborg ist das Geschöpf einer Post-Gender-Welt, Hybrid aus Mensch und Maschine, welche die Grenzen zwischen natürlich/künstlich, innen/außen, normal/pervers oder männlich/weiblich zusammenbrechen lässt. Als Grenzgängerin verwischt die Cyborg diese scheinbaren Gegensätze, denn sie befindet sich in einem Zustand, der jenseits dieser Gegensätze liegt. Sie ist damit die Paradefigur des oben eröffneten _, denn anstatt ‹nur› eine Störung der gegebenen Ordnung zu sein, kündigt die Cyborg das Heraufziehen von neuen Körpersubjektivitäten an. An den Anfang setzt Haraway dann auch die Frage: «Warum sollte unser Körper an unserer Haut enden?»5 Ich will mich auf die Spur dieser Frage begeben und drei verschiedene Cyborg-Szenarien rund um Körper, Geschlecht und Sexualität betrachten:
‹Alles was wahr ist...›
Warum sollten nur die Praxen, die wie das Einnehmen von Hormonen oder kosmetisch-operative Eingriffe «unter die Haut» gehen, unseren Geschlechtskörper verändern? Eine solche Position würde gänzlich den gesellschaftlich-phantasmatischen Anteil an unserem Körper verkennen. Denken wir beispielsweise an die Gummischwänze und Gummibrüste, wie sie von Crossdresser_Innen gerne getragen werden. Warum sollten sie nicht Teil des Körpers sein? Weil sie sich nicht echt anfühlen? Aber was soll denn bitte «echt anfühlen» heißen? Fühlen sich die abgebundenen Brüste einer butch etwa echter an als meine Gummititten? Ich fühle sie sehr wohl, ich spüre sie als Teil meines Körpers, es erregt mich, wenn meine Freund_In daran herumfummelt. Und dass sie nicht Teil meines Körpers sein sollten, auf diese Idee würde ich nicht kommen. Ich kann vielleicht keinen Brustkrebs bekommen, noch kann ich mein Baby stillen, aber sollen das etwas die Merkmale sein, die darüber entscheiden, ob meine Brüste ein Teil meines Körpers sind oder nicht?
Den Begriff des Geschlechtskörpers gänzlich davon abzukoppeln, wie er auf der einen Seite von den Einzelnen gefühlt und auf der anderen Seite von anderen rezipiert wird, heißt die Vorstellung davon, was ein Körper ist und sein kann, auf eine seltsame Weise zu versperren. Und indem wir diese gesellschaftlich-phantasmatische Dimension unseres Körpers anerkennen, eröffnen sich uns neben den altbekannten Möglichkeiten eine Reihe neuer Körpersubjektivitäten, die auszuprobieren wir eingeladen sind. Die Trennung von sex und gender hält diesem Spiel nur insofern stand, als sie die «unhintergehbare Faktizität» unseres sex hinter sich lässt und anerkennt, dass unser Biogeschlecht immer auch ein soziales ist. Eines, dem wir uns auf verschiedenste Weise bemächtigen können und das wir de- und rekonfigurieren können, um neue Kombinationen zwischen den verschiedenen «Geschlechtsmerkmalen» herzustellen.
Dieser Diskurs «primärer», «sekundärer» und «phantasmatischer» Körpermerkmale ist jedoch selbst wieder zu hinterfragen. Die Aneignung verqueerer Geschlechtspositionen besteht längst nicht ausschließlich darin, körperliche Kohärenzvorstellungen zwischen Vagina, Brüsten und Penis neu zu ordnen – auch wenn darin lustvolle und verführerische Möglichkeiten liegen.
‹...ist das was war...›
Unser Geschlecht ist noch auf eine ganz andere Weise in unseren Körper verstrickt. Insofern unser Körper auch immer ein wissender Körper ist, Speicher einer Unzahl von gesellschaftlich normierten Handlungs- und Verhaltensweisen, kann die Aneignung des _ auch etwas ganz anderes bedeuten als die Aneignung von «primären» oder «sekundären» Geschlechtsmerkmalen. Einen Körper zu haben heißt aus dieser Perspektive, ein Set an Inszenierungspraktiken zu beherrschen, das jederzeit abrufbar und einsetzbar ist. Praktiken, die wir nicht bewusst ausführen oder ausüben, sondern die vielmehr in unseren Körper auf scheinbar «natürliche» Weise eingelagert sind. Wir kennen es zur Genüge: Jungs sitzen gern breitbeinig und spielen gern mit Autos, wohingegen Mädels mehr auf ‹Backe backe Kuchen› und die keusch verkreuzten Beinchen stehen...
Was unseren Körper zu einem geschlechtlich bestimmbaren macht, ist eine spezifische Art des Seins, sein Habitus. Dieser besteht aus einem Bündel von Alltagspraxen, das vom wohl geschulten Augenaufschlag bis zum gekonnten Hüftschwung, vom lässigen Gang bis zum selbstsicheren Ton in der Stimme reicht. Ein Knäuel aus kosmetischen, gestischen und sprachlichen Verhaltensweisen verdichtet sich hier zu dem, was unserem Körper sein Geschlecht erteilt. Was aber, wenn diese Codes neu zugeordnet werden, wenn boyz beginnen sich aufzutakeln und ihren body sexy durch die Straßen schwingen, oder wenn grrrls breit und rotzig daherstampfen? Dann verändert sich nicht nur einfach eine Repräsentation oder Inszenierung, sondern ein Verhältnis zum eigenen Körper, ein Gefühl, was es heißt, dieser Körper zu sein und er sein zu wollen. Was nun, wenn diese Neucodierung subtiler und vielachsiger verläuft? Wenn sie sich nicht einfach an den gängigen Geschlechtergrenzen orientiert, um deren Stereotype auszutauschen? Welche Körper werden wir dann sein? Der Punkt ist, dass unsere Verhaltensweisen nicht auf unseren Körper aufgesetzt sind, sondern ihn erst zu einem Körper machen, der sich auf eine bestimmte Weise anfühlt und der auf eine bestimmte Weise wahrgenommen wird, kurz: der ist.
Beispielhaft möchte ich hier die maskuline Lesbe, die butch, anführen. In ihrer Geschlechterinszenierung eignet sie sich verschiedene Codes von Maskulinität an6, die es ihr jenen souveränen Status anzunehmen erlauben, der sonst dem männlichen Subjekt vorbehalten bleibt. Dieser Prozess der Selbstermächtigung ist das Einsetzen eines neuen Geschlechtskörpers. Die durch Umarbeitung hinterlassenen, überstehenden Ränder und Überlappungen machen aus der butch nicht einfach einen Mann – der sie auch gar nicht sein will. Vielmehr machen sie ihre Aneignungsbewegungen zu jener erotischen Gestalt, die sich im _ zwischen den Geschlechter eingerichtet hat.
‹...nicht mehr wahr ist.›
«Queer sex is great!» ist an Kreuzberger Häuserwänden zu lesen – und es stimmt, queere Sexualität ist sexy. Dass sich hier neue und aufregende Konfigurationen verbergen, das hat auch die Pornobranche für sich entdeckt. So dürfen nun auch Trans-People – oder besser gesagt «big dicked shemales» – für die Kamera blasen, ficken und abspritzen. Was damit in Frage gestellt wird, ist die Vorstellung einer ausschließlich heterosexuellen Lust, denn die traditionellen Begriffe greifen hier längst nicht mehr. An was ergötzt sich denn der/die Zuschauer_In, wenn Frau oder Mann mit Trans_mann oder Trans_frau fickt und bläst? Schwul ist das nicht, lesbisch auch nicht und hetero schon gar nicht, aber was dann? Diese Art der Irritationen ist jedoch auch schon alles, was uns der Queer-Porno an «subversivem Potential» zu bieten hat. Denn unangetastet wird hier das Primat genitaler Lust mitsamt seines patriarchal-sexistischen Gehalts übernommen. Übergangen wird so, dass Voyeurismus, Fetischismus und S/M auch auf andere Art und Weise als in einer aggressiv-männlichen Sexualität in unsere Sexspiele eingehen können.
Queere Sexualität lässt den genital-patriarchalen Sex zugunsten eines ‹perversen Begehrens› hinter sich, das haben verschiedene Queertheoretiker_Innen zu zeigen versucht. Perverses Begehren, das gemeinhin ab dem Moment als pervers gilt, wo es von seiner reproduktiven Funktion abgekoppelt ist, ist für sie Teil einer postgenitalen Erotik, die sich am Fetisch orientiert. Damit ist eine Erotik gemeint, die sich nicht mehr über die Härte des männlichen Sex definiert, sondern die eine neue Sprache des Körpers entdeckt. Die Phantasie spielt bei dieser Neubesetzung eine entscheidende Rolle. Die Zonen der Lust und des Begehrens werden über sie an Fetischobjekte vermittelt, die nicht mehr an jene Zonen traditioneller Heteroerotik gebunden sind. Die so zugelassenen vielfältigen repräsentationalen Besetzungen erlauben eine Re-/Erotisierung von Bereichen, die unter dem Primat heterosexueller Lust unzugänglich waren.
Teresa de Lauretis, eine der bekanntesten Queertheoretikerinnen, sieht das perverse Begehren in der lesbischen Beziehung zwischen butch und femme am Werk. Zentrales Element des gegenseitigen Begehrens bilden hier nicht einfach die traditionell erotisierten Gebiete des Körpers, sondern einzelne, phantasmatisch durchsetzte Elemente der Erscheinung oder Selbstdarstellung sowie die Präsentation physischer, intellektueller oder emotionaler Eigenschaften. Gerade weil sich die Erotik auf solche Zeichen verschiebt, die an eine begehrliche Phantasie gebunden sind, spielt die Maskerade in den butch/femme-Beziehungen eine so wichtige Rolle. Gegenseitiges Begehren ist hier vor allem ein gegenseitig geteiltes Phantasieszenarium. Entscheidend ist dabei die eröffnete Abkehr von einer genital fixierten Körperlichkeit zugunsten einer Hingabe an Codes und Zeichen, welche die Gesamtheit des Körpers neu zu besetzen vermögen.
Aneignung revisited
Die angeführten Szenarien zeigen, welche neuen Konfigurationen von Körper und Geschlecht uns offen stehen. Die Aneignung eines Raumes «in between», des _, verändert, was als Erfahrung von Geschlecht und Körper möglich ist und war. Die Aneignungsbewegungen, die wir betrachtet haben, erlauben uns nun den Begriff «geschlechtliche Aneignung» etwas genauer zu fassen. Zunächst einmal zeigt sich, dass Aneignung immer eine praktische Tätigkeit im Verhältnis zur Welt bedeutet, eine Tätigkeit, die mehr ist als einfaches Besitzergreifen7. Sich etwas zu Eigen machen ist mehr als nur etwas äußerlich zu ‹haben›. Aneignung ist vielmehr mit Durchdringung und Hingabe verbunden. Anders als beim ‹Kaufen› oder ‹in Besitz nehmen› ist das ‹zu eigen machen› ein offener Prozess, dessen Ende nicht klar zu bestimmen ist. Hier handelt es sich nicht um das einfache Ablaufen eines vorkalkulierbaren Prozesses oder das souverän-überschauende Handeln eines männlichen Subjektes. Vielmehr geht es darum, sich auf etwas einzulassen, oder besser: sich von etwas verführen zu lassen, von dem wir nicht im Vorhinein wissen, was es ist. Geschlechtliche Aneignung ist eine Praxis. Eine Praxis, welche durch Offenheit gekennzeichnet ist. Damit ist sie eine Praxis für neugierige, nicht-souveräne und antipatriarchale Subjekte.
Auf diese Weise ist auch ein grundlegender Unterschied zu einem marxistischen Aneignungsbegriff benannt: Es gilt nicht, etwas Verlorenes, ursprünglich Eigenes wieder anzugeignen. Hier wird nicht aus der Perspektive der Entfremdung gesprochen, sondern aus der Perspektive lustvoller und ungewisser Neugierde. Aneignung bedeutet hier keine Rückkehr, kein Zurück zu einem Zustand, der jetzt schon zu benennen wäre. Vielmehr ist dieser Prozess durch seine Ungewissheit gekennzeichnet, wie sie eine undogmatisch-emanzipatorisch Linke besitzen sollte.
Eine Politik der Aneignung zeichnet sich durch ihren positiven und ermöglichenden Charakter aus. Grenzen, Schranken und Barrieren werden nicht dadurch sichtbar gemacht, dass sie zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit von aufklärerischen Aktionen gemacht werden. Attackiert werden sie vielmehr dadurch, dass sie überschritten werden und dass eine Bandbreite an verlockenden Möglichkeiten aufgezeigt wird, die wir uns nehmen können und sollten. Diese Politik ist nicht mehr durch jene defensive Haltung gekennzeichnet, wie sie viele von uns kennen, sondern durch eine offensive Politik der Überschreitung und der Leidenschaft. Das hat auch die Betrachtung verschiedener geschlechtlicher Aneignungsformen gezeigt, ohne Zweifel eine Praxis, die auf Hindernisse trifft und die mit schmerzlichen Erfahrungen verbunden ist, da, wo sie auf Widerstände, die scharfen Kanten und stumpfen Grenzen des Systems trifft, die jedoch einen grundlegend positiven und lustvollen Charakter hat. Im Gegensatz zum frustrierenden «Aufklärungsalltag» liegt hier ein Potential linker Praxis, das mit Spaß, Lust und Erotik verbunden ist.